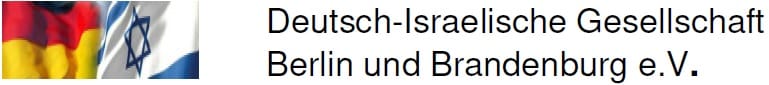Ein Reisebericht von Nikoline Hansen.
Und hier finden Sie ihre wunderbare Fotogalerie zur Reise.
25.05. Das Programm war gedrängt: neun Tage sind kurz, wenn man sich einen umfassenden Überblick über die politische Situation und die historische Tradition eines Landes verschaffen will, das zwar klein aber zugleich überfrachtet ist – mit Erwartungen und Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft und Religion. Gleich nach unserer Ankunft durften wir uns bei einem Bummel durch Jaffo einen Eindruck davon verschaffen, wie sich diese alte Stadt im Laufe der Jahre zu einer Attraktion für Touristen – und in eine Fotokulisse für Brautpaare verwandelt hat. Dabei ist sie einerseits dabei, sich als Vorort von Tel Aviv zu emanzipieren, andererseits wächst sie aufgrund der immensen Bauaktivitäten immer weiter in die Stadt hinein. Der Blick auf die Tel Aviver Strandpromenade Tajeled ist nach wie vor malerisch, das arabische Ambiente auf den ersten Blick kaum noch erkennbar. Fast wirkt der Ort jetzt ein wenig steril, kurz davor, seinen lebendigen Charme zu verlieren, aber vielleicht war das auch nur der persönliche Eindruck einer kurzen Momentaufnahme nach einem anstrengenden Flug.
Nach dem Abendessen im Hotel führte Gil Yaron, Journalist und Publizist, mit seinem Vortrag „Israel im Nahost-Konflikt – Geschichte und gegenwärtige Situation“ in das Thema ein, das uns die nächsten Tage beschäftigen sollte. Er stellte besonders die psychologische Komponente heraus, die für das Verständnis des Nahostkonflikts von entscheidender Bedeutung sei. Bei dem Konflikt handele es sich im Prinzip um einen jahrtausendealten Stellvertreterkrieg. Dabei seien die Bündnisse fluide und eine der Ursachen für das ständige Chaos sei Israels Politik: man agiere. Dafür hätten Europäer in der Regel wenig Verständnis, denn sie machten erst einen Plan und handelten dann danach. Weiterführende Informationen und aktuelle Einschätzungen zu Nahost bietet Yaron im Internet unter der Adresse http://www.info-middle-east.com/ und http://www.go-jerusalem.de/blog/ .
26.5. Besuch des Yitzhak Rabin-Gedenkortes am Rabinplatz. Der Ort, an dem der israelische Ministerpräsident am 4. November 1995 von einem fanatischen Juden ermordet wurde, ist durch einen Gedenkstein, eine Bronzeplastik und eine Wand mit Graffities aus der Zeit nach seiner Ermordung gekennzeichnet. Im Boden sind zwei kleine runde Metalltafeln eingelassen, die kennzeichnen, wie nahe der Mörder an sein Opfer herangekommen war. (Das Denkmal hat derzeit durch die Ergänzung mit drei überlebensgroßen Schwarzweißfotos neue Plastizität erfahren, ein Hinweis auf eine im Rathaus gezeigte Ausstellung ohne Bezug zu Rabin.)
Im Anschluss daran trafen wir in der Deutschen Botschaft http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/DeutscheAVen/Israel/DeutscheVertretungen.html , Gregory Bledjian, 1. Sekretär in der Politischen Abteilung, der uns kenntnisreich die Aufgaben der Deutschen Botschaft im Hinblick auf die deutsch-israelischen Beziehungen und erfrischend offen sowie mit einem besonderen Blick auf die arabische Minderheit die gegenwärtige politische Lage in Nahost erläuterte. Das Interesse an der Botschaft sei groß: man habe eine hohe Besucherdichte, wenigstens einmal pro Woche auch von Politikern aus Deutschland. Es gehe um Themen wie Jerusalem, Siedlungspolitik, Terrorismus und die arabische Minderheit. Dabei betonte Bledjian, dass die Politik der Bundeskanzlerin die Beziehungen mit der arabischen Welt nicht einfacher machten: Aus arabischer Sicht käme die als proisraelisch empfundene Haltung Angela Merkels nicht gut an. Im Vordergrund der deutsch-israelischen Beziehungen stünden Ausbildung, Wissenschaft und Kulturaustausch.
Zwar gebe es noch keine direkten Regierungskonsultationen mit den Palästinensern, man betreibe aber schon jetzt eine enge Entwicklungszusammenarbeit im Hinblick auf den Aufbau staatlicher Strukturen (Rechtssystem, Sicherheitsmaßnahmen, funktionierende Verwaltung), um die Gründung eines Staates überhaupt zu ermöglichen: „Deutschland ist ein enger Partner und einer der größten Geber“, so der Botschaftsvertreter. Dazu war am 18. Mai in Berlin erstmals ein deutsch-palästinensischer Lenkungsausschuss zusammen gekommen, der auf Initiative des palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayad Grundlagen für den Aufbau staatlicher Strukturen schaffen solle. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern gestalteten sich allerdings als schwierig. Es könne nur mittelbare, also indirekte Friedensgespräche geben, da keine Bereitschaft bestehe, direkt miteinander zu reden: die Hamas erfülle im Gegensatz zur Fatah von Mahmud Abbas die Voraussetzungen dafür „auch nach internationalen Kriterien“ nicht. Ungeklärte Punkte in den Verhandlungen mit der Autonomiebehörde seien vor allem die Wasserproblematik und Flüchtlingsfragen; die Bewegungsfreiheit der palästinensischen Bevölkerung sei fast komplett eingeschränkt, trotz aller Bemühungen gebe es keine Fortschritte, so auch im Fall des am 26. Juni 2006 im Gazastreifen von der Hamas entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit Mehr dazu unter: http://www.habanim.org/en/German.html.
Auch die Flotte mit Baumaterial, die in Richtung Gaza unterwegs sei, mache die Lage nicht besser: Sowohl der Libanon als auch Israel fühlten sich bedroht. Der Iran sei für Israel das Hauptproblem. Obwohl es hier unterschiedliche Denkschulen gebe, würde die Bedrohung im Land als existentielle Bedrohung wahrgenommen und als real empfunden. Eine „ständige Maßnahme“ der deutschen Botschaft sei deshalb auch das Vorhalten einer Liste deutscher Staatsbürger für eventuell notwendig werdende Evakuierungsmaßnahmen. Bledjian wies darauf hin, dass Israel kein NATO-Staat sei, die völkerrechtliche Beistandspflicht im Falle eines Angriffs also nicht greife: „Wir flankieren politisch alle Bemühungen, aber halten uns raus“. Im Übrigen sei man der Ansicht, Israel habe alle Mittel sich selbst zu verteidigen.
Dass nicht nur Geschichte, sondern auch die Ur- und Frühgeschichte bzw. Archäologie politisch ausgelegt werden könnten, zeigten die Ausgrabungen am Tempelberg, mit deren Hilfe israelische Siedler territoriale Ansprüche begründeten, so Bledjian. Die Aufrufe zum Bau eines 3. Tempels würden wiederum von palästinensischer beziehungsweise islamischer Seite instrumentalisiert. Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Tatsache, dass der Konflikt wegen Armut und Perspektivlosigkeit immer stärker religiös aufgeladen würde, wäre eine möglichst schnelle Lösung des Konflikts wünschenswert, denn: „es wird nicht einfacher“. Dabei spiele der Iran eine sehr destruktive Rolle: „Noch nicht einmal die Israelis selbst glauben, dass sie in der Lage sind das Problem zu lösen“. Denn als Folge der Erfahrungen im Irak setze der Iran zur Entwicklung seines Atomprogramms nicht nur auf dezentrale, sondern auch auf unterirdische Lösungen. Selbst ein militärischer Angriff könne das Programm nicht beenden, sondern allenfalls um ein paar Jahre zurückwerfen, so der Botschaftsvertreter.
Um unserem Besuch des „Heiligen Landes“ nach diesem interessanten Informationsgespräch eine weitere Krönung aufzusetzen, war um 11:00 eine landesweite Zivilschutzübung angesetzt, bei der alle Israelis aufgefordert waren sich zu beteiligen, wovon wir allerdings wenig mit bekamen.
Derart eingestimmt machten wir uns auf den Weg zu einer kurzen Stadtrundfahrt Richtung Allenby Straße und besuchten dort den Fotoladen „Zalmania PRIOR“, wo wir Miriam Weissenstein, Witwe des Fotografen Rudi Weissenstein, und ihren Enkel Ben Peter trafen. Ebenfalls gekommen war Andreas Grau-Fuchs, Kurator einer Ausstellung über Weissenstein, die vom 18. Februar bis 30. April 2010 in Frankfurt zu sehen war, jetzt durch die Bundesrepublik tourt und im nächsten Frühjahr nach Berlin kommen soll. Vor Ort konnten wir uns über die Probleme im Zusammenhang mit der notwendigen Renovierung des Gebäudes und der Archivierung und Konservierung des historischen Filmmaterials informieren und mit dem Kauf von Postkarten einen kleinen Teil zum Erhalt dieses wertvollen Stücks Kulturerbe beitragen. Im Berliner Tagesspiegel war am 5.4.2009 ein Bericht von Igal Avidan zu dem Fotoladen erschienen, den die meisten von uns kannten und der hier zur Lektüre empfohlen sei: http://www.tagesspiegel.de/zeitung/bilder-einer-stadt/1488366.html .
Unser nächster Programmpunkt führte uns in das Kinderheim Neve Hanna (http://www.nevehanna.org/ ) nahe Kiryat Gat, wo wir von Antje Naujoks mit einem liebevoll vorbereiteten Mittagsimbiss empfangen wurden. Neve Hanna, 1974 gegründet von Hanni Ullmann, hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem aufwändigen pädagogischen Konzept auffällig gewordene Jugendliche zu betreuen und ihnen eine Perspektive zur Integration in die Gesellschaft zu geben. Dabei geht es in der Regel nicht nur um einzelne auffällig gewordene Kinder, sondern auch um deren Familien. Die Kinder werden dem Heim von den israelischen Sozialbehörden überstellt, die auch einen Teil der Kosten übernehmen (60%, die übrigen 40% müssen aus Spenden aufgebracht werden). Sie kommen aus Familien, in denen Drogensucht, Prostitution, Kriminalität und Gewalt an der Tagesordnung sind. Neve Hanna ist mit seiner Arbeit überaus erfolgreich, nicht nur, weil es die Kinder, die im Programm aufgenommen werden, sorgfältig auswählt, sondern auch, weil das integrative Konzept stimmt. Die hauseigene Bäckerei dient dabei nicht nur einem Zuverdienst, sondern ist gleichzeitig Ansporn für die Kinder, Leistung zu erbringen und sich nützlich zu machen. Die Besichtigung der Wohngemeinschaften, in denen die Kinder leben, zeigte, dass das Konzept aufgeht: das anfängliche Misstrauen gegenüber den Besuchern wich innerhalb kürzester Zeit Interesse und Stolz, die eigenen Errungenschaften – vom Bett über das Schulbuch – zu präsentieren und mit Händen und Gesten zu kommunizieren – denn die meisten Teilnehmer unserer Reisegruppe verstanden kein Hebräisch. Viele Kinder in Neve Hanna kommen aus äthiopischen Familien, andere aus Beduinenfamilien, und alle gemeinsam lernen Ästhetik, Sauberkeit und Ordnung als Konstante in ihrem Leben zu achten und wertzuschätzen. Auch das konservative Judentum und die religiöse Erziehung nehmen einen wichtigen Stellenwert ein. Eine Bibliothek, eine Synagoge, ein Sportgelände, ein Spielplatz und ein Streichelzoo machen das Kinderheim zu einem Ort, an dem es sich trotz der Bedrohung aufgrund der Nähe zum Gazastreifen gut leben lässt: Während des Gazakriegs war auch Kiryat Gat im Süden Israels regelmäßig Raketenbeschuss ausgesetzt, der Bunker Zufluchtsort gewesen.
Die letzte Station des Tages war ein Frauenprojekt in der Beduinenstadt Lakiya (http://www.lakiya.org/ ), das von der israelischen Organisation „Shatil“ unterstützt und aufgebaut wurde. Die Frauen betreiben eine Weberei und verkaufen ihre Produkte – Teppiche, Kissenbezüge, Schals, Taschen u.ä.- an die Besucher. Damit erreichen sie ein Stück mehr Freiheit. Durch das Erwirtschaften eigener Mittel wollen die Mütter ihren Töchtern bessere Bildungschancen ermöglichen.
Die Beduinen gehören zu den ärmsten Minderheiten Israels, die Analphabetenrate der Frauen beträgt 90%. Die Frauenorganisation „Sidreh“ wurde 1998 als gemeinnützige Organisation registriert und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rechte der Frauen und ihr Bewusstsein für ihre eigene aktive Rolle in der Gesellschaft zu stärken.
Der gemütliche Ausklang des Abends in einem Liegestuhl am Tel Aviver Strand bei einem Glas Rotwein und lauer Luft war ein weiteres Kontrastprogramm dieses eindrucksvollen zweiten Reisetages.
27.5. Fahrt zum Kibbuz Tel-Yitzhak nahe Netanjia, der Massuah beherbergt, ein Museum und eine Bildungsstätte zur Erinnerung an den Holocaust ( http://www.massuah.org.il/ ).
Auf dem Weg dorthin erlebten wir auf der gegenüberliegenden Seite eine Straßensperrung um einen herrenlosen Koffer nahe einer Bushaltestelle. Eine Spezialeinheit der israelischen Polizei, unterstützt durch einen Roboter – inspizierte den Ort – auch dies ein Bild, das in Israel zum Alltag gehört.
Massuah spielt eine zentrale Rolle in der israelischen Erziehung, denn zweifellos ist die Shoah das identitätsstiftende Moment in der multikulturellen Gesellschaft Israels. Die Ausstellung konzentriert sich auf den Eichmann-Prozess, der für Israel von enormer moralischer Bedeutung war und ist. In der Dokumentation sind auch die Zeugen zu sehen, die in diesem Prozess aussagten, unter ihnen der deutsche Pfarrer, Probst Heinrich Karl Ernst Grüber (das „Büro Grüber“, das zwischen 1938 und 1940 rund 1138 zum Christentum konvertierte Juden und ihre Familien in der Nazizeit rettete, unterstand ab 1939 der Kontrolle von Adolf Eichmann. Grüber wurde 1966 zum Ehrenpräsidenten der DIG ernannt).
Die im Museum in Massuah zuletzt hinzugekommenen Memorabila sind die Handschuhe, die der israelische Mossad-Agent Zvi Malchin während der Festnahme Eichmanns trug. Sie werden im Schaukasten neben einer handschriftlichen Erklärung Eichmanns gezeigt, die mit den Worten beginnt: „Ich, der Unterzeichnende, Adolf Eichmann, erkläre hiermit aus freiem Willen …“ – ein zentrales Dokument, das für die „Ausreise“ aus Argentinien benötigt wurde. Denn Eichmann wurde mit dem ersten Auslandsflug der gerade gegründeten israelischen Luftfahrtgesellschaft El Al in einer Geheimdienstoperation nach Israel gebracht – zwischen Argentinien und Israel bestand kein Auslieferungsabkommen.
Die Festnahme Eichmanns bedeutete für den Staat Israel eine Umkehr der Stärke, des Täter-Opfer-Verhältnisses. Und sie war wie der folgende Prozess zugleich Zeichen für die jüdische Souveränität, die sich im Staat Israel manifestierte. Dabei war die Darstellung der Umkehr der Opfer in eine Position der Stärke auch hilfreich zur Bewältigung der Vergangenheit, der traumatischen Ohnmachtserfahrung. Wenn man die Geschichte aus dieser Perspektive betrachtet, liegt es auf der Hand, dass der Prozess gegen Eichmann, den Hannah Arendt seinerzeit kritisch begleitete, ein wesentlicher Antriebsmotor für die Entwicklung und Stärkung des jüdischen Staates war. Es ging – auf moralischer und ethischer Ebene – um die Herstellung von Gerechtigkeit.
Massuah ist ein Ort, der sich als Ort der kollektiven Erinnerung mit der kulturellen Identität Israels befasst, in dem der Holocaust eine zentrale Rolle spielt, und an dem zugleich die ethischen Probleme thematisiert werden, die sich aus der Komplexität und Widersprüchlichkeit im Hinblick auf menschliches Handeln ergeben: Was macht den Menschen zum Menschen? Auf Grund der Kürze der Zeit konnten wir diese Themen nicht erschöpfend erörtern, es blieb bei einem Verweis auf den amerikanischen Film „Blade Runner“ und den Hinweis darauf, dass im KZ der Begriff Muselmann für todgeweihte Mithäftlinge Verwendung fand – ein Phänomen, über das ebenso weiter nachzudenken gilt wie über die Tatsache, dass Recht im Sinne geschriebener Gesetze und Gerechtigkeit manchmal nur wenig gemein haben.
Weiter ging es mit einem Abstecher ins römische Caesarea mit seinem Amphitheater direkt am Mittelmeer nach Haifa zum Technion, der ältesten Hochschule Israels, deren Gründung maßgeblich auf die Initiative deutscher Juden noch vor dem Ersten Weltkrieg zurück geht. Im neuen Teil der Universität hörten wir einen Vortrag über Forschung und Entwicklung sowie über die Besonderheiten in der deutsch-israelischen Wissenschaftskooperation und machten im Anschluss einen Rundgang über den mit vielen Kunstwerken, u.a. einer Säule von Santiago Calatrava, und einem modernen Amphittheater ausgestatteten Campus. Vorbereitet wurde der Besuch von der Deutschen Technion Gesellschaft e.V. ( http://www.deutsche-technion-gesellschaft.de/ ).
Nach einem kurzen Blick über die Bahai-Gärten kamen wir gerade noch rechtzeitig zum Abendessen ins Hotel. Wer noch Energie hatte, konnte danach einen Ausflug in die Szene-Kneipen im deutschen Templer-Viertel unternehmen. Ich selbst durfte in der Zeit dem Buchenwald-Überlebenden Naftali Fürst einen Besuch abstatten und hörte am Ende von seiner Frau Tova eine Geschichte, die geeignet war, noch einmal über die Frage „Was macht den Menschen zum Menschen?“ nachzudenken.
28.5. Besuch im Kibbuz Lochamej Hageta’ot. Der Kibbuz, ursprünglich von polnischen Überlebenden gegründet, beherbergt heute das sogenannte Ghettokämpfer-Museum, das nicht in erster Linie eine Ausstellung zeigt, sondern vor allem ein Lernort sein soll, dessen pädagogisches Konzept besonders auf Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren zugeschnitten ist (http://www.gfh.org.il).
So wurden nicht nur die Zeugnisse Überlebender gesammelt und in einem Gedenkbuch dokumentiert, mit dem Yad HaYeled entstand vor einigen Jahren auch ein Kindermuseum. Im Rahmen eines kleinen Rundgangs werden jeweils etwa fünfminütige Videos gezeigt, in denen damals überlebende Kinder aus heutiger Perspektive schildern, wie sie den Verlust ihrer Verwandten erlebten, wie ihnen von anderen Menschen, die keine Juden waren, geholfen wurde zu überleben und wie sie in Israel neu anfangen konnten. Die Dokumentation dieser Geschichten kommt gerade noch rechtzeitig – die Kinder, die den Holocaust überlebt haben, sind inzwischen selbst Großeltern. Das Museum ist in Form einer Spirale angelegt, die die Geschichte nacherleben lässt – der Rundgang dreht sich als ginge er nie zu Ende, die Räume werden kleiner und dunkler, und doch kommt man am Ende wieder ans Licht: durch den Krieg verändert, aber mit viel Kraft zum Weiterleben. Der Museumsbesuch ist für Jugendliche, die dort Workshops machen, eingebettet in eine fünfstündige Einführung ins Thema und endet mit der Verarbeitung des Gesehenen und Erlebten in Form von Kunst.
Die Diskussion mit Tanja Ronen, die das Konzept selbst mit entwickelt hat und eng mit deutschen Gedenkstätten zusammenarbeitet, verlief spannend. Angesprochen auf die innerjüdische Diskussion zum Umgang mit dem Holocaust sagte sie, sie sei ganz bei Iris Hefets, die Israel als „psychotische Gesellschaft“ bezeichnet. Dennoch: Man dürfe von der ersten Generation nicht zu viel erwarten, und „wahrscheinlich ist die zweite Generation genauso traumatisiert wie die erste.“. Es handele sich um ein „Gesellschaftstrauma“ in Israel und die gegenwärtige Situation der anhaltenden Bedrohung des Staates lasse eine Aufarbeitung des Traumas nicht zu. Aber man müsse aufpassen, dass es nicht zu einer „Selbstzerstörung durch Überfrachtung“ („overflow“) komme. Auch deshalb sei die Konzentration auf ein positives Ende wichtig: Es gibt die Überlebenden und es gibt Vorbilder, die den Weg in die Zukunft weisen können.
Ebenfalls zum Kibbuz, der in einer historisch beeindruckenden Umgebung mit einem antiken Amphitheater und einem gut erhaltenen Aquädukt nach Akko liegt, gehört das Dokumentationszentrum, genannt „Haus des Zeugnisses“. Hier werden die persönlichen Aussagen der Ghettokämpfer präsentiert, das Zeugnis der 150 Menschen, die den Kibbuz 1953 gegründet hatten. Auch hier geht es darum, die Vergangenheit nicht zu vergessen: die Verwandten und Familien in Erinnerung zu rufen, das Entstehen der israelischen Gesellschaft aus der Nachkommenschaft des europäischen Judentums zu begreifen und schließlich die Vergangenheit zu kennen, um gegen künftige Gefahren gewappnet zu sein. Die Ausstellung wurde 1958 eröffnet und wird gerade überarbeitet. Sie hat viele Aspekte, die wir in den wenigen Stunden unseres Besuchs nicht alle behandeln konnten. Ein wichtiges Thema, das von jungen Israelis in den dort stattfindenden mehrtägigen Seminaren erörtert wird, ist das Thema „Widerstand und Terrorismus gestern, heute und morgen“. Das Museum leistet damit zugleich einen Beitrag zur Vermittlung lebendiger Geschichte, die zur Übernahme persönlicher Verantwortung und moralischem Handeln auffordert.
Im Anschluss stand der Besuch von Akko auf der Tagesordnung, ein Rundgang durch die alte Festung und das arabische Stadtviertel, das auch in freitäglicher Ruhe immer wieder fasziniert und wo man selbst bei sommerlicher Hitze gemütlich am Meer im Fischrestaurant neue Kraft schöpfen kann. Im Anschluss stand die Weiterfahrt zum nördlichsten Punkt Israels am Mittelmeer, die Felsen von Rosh Hanikra an der Grenze zum Libanon, auf dem Programm. Der beliebte Fotopunkt für alle Reisegruppen zeigt: Von hier aus sind es 205 Kilometer bis Jerusalem, 120 bis Beirut.
Dann ging es weiter nach Tiberias am See Genezareth. Hier ergab sich am Abend erstmals die Gelegenheit, alle Mitreisenden in einer großen und dennoch gemütlichen Runde in lauer Abendluft auf der Terrasse kennenzulernen.
29.5. Fahrt zum Golan durch eine Landschaft, die bereits von der sommerlichen Hitze und Bränden gezeichnet war . Nur wenige Stunden zuvor hatte ein großer Brand im Naturschutzgebiet des Hula-Tals um Ramla schwere Schäden verursacht. In Begleitung von General i.R. Arik Beckenstein und seiner Frau Edna konnten wir einen umfassenden Einblick in die strategische Lage des Landes an der Grenze zu Syrien gewinnen. Beckenstein, der 1967 und 1973 auf dem Golan gekämpft hatte und dessen Vater Bataillonschef im Unabhängigkeitskrieg 1947/48 gewesen war, schilderte die Sicherheitsbedürfnisse Israels sehr eindrucksvoll. Israel ist mit seinen 22.145 Quadratkilometern in etwa so groß wie Hessen – ein schmaler Streifen am Rande des Mittelmeers. Diese Größenordnungen sollte man sich bei jeder Diskussion um die Sicherheit Israels immer wieder vor Augen führen. Dazu kommt, dass von den siebeneinhalb Millionen Einwohnern zwanzig Prozent arabischer Herkunft sind – auch dies ist wenig bekannt. Am Aussichtspunkt Mizpe Gadot, ehemals syrisches Gebiet, konnte Beckenstein uns den Kampf um die Golanhöhen und ihre strategische Bedeutung für Israel anschaulich nahe bringen. Reste von Bunkern sind am Aussichtpunkt zu einem Mahnmal geworden, ergänzt durch ein Denkmal für die gefallenen israelischen Soldaten, an dem die Reste blauweißer Schleifen von lebendiger Erinnerung zeugen. Danach ging es weiter mit dem Reisebus zum nächsten Aussichtpunkt mit einem Blick auf das UN-Hauptquartier im „Niemandsland“, wo wir auf österreichische UNIFIL-Soldaten trafen. Sie verrichten dort ihren täglichen Dienst: die Begegnung mit ausländischen Touristen ist dabei eine willkommene Abwechslung im öden Alltag. So stellt man sich das Soldatenleben in Nahost nicht vor: stundenlanges Beobachten einer kargen Landschaft und Langeweile – was ja auch ein Glück ist!
Nach diesem kurzen Ausblick fuhren wir weiter zur nördlichen Spitze Israels in Richtung des Hermon-Berges, den Israel zu seinem Skigebiet gemacht hat, vorbei an der mächtigen und eindrucksvollen Kreuzfahrerburg Nimrod in das Naturschutzreservat Banyias. Durch dieses Gebiet, das Israel 1967 teilweise erobert hat, fließt der Hermon-Fluß. Hier finden sich die Reste vieler vergangener Zivilisationen – Ruinen eines griechischen Tempels für den Gott Pan, eine römische Brücke und Wassermühle, ein Torbogen aus Zeiten der Kreuzfahrer, dazu dichte Wälder mit alten Bäumen und Wasserfälle – eine für Israel ungewöhnliche Landschaft. Der Hermonfluss oder Banyias ist einer der beiden Quellflüsse des Jordans und seine Temperatur steigt auch im Sommer nicht über 16 Grad Celsius – ein guter Grund, die Füße in dem Fluss zu kühlen, der zugleich christlicher Wallfahrtsort ist und ein schöner Abschluss unserer Exkursion, die den von Israel ungewollten Kriegen und dem Überleben des israelischen Staates gewidmet war.
Am Abend noch ein Spaziergang vom Hotel zur Strandpromenade von Tiberias, wo eine lebhafte Einkaufsstraße und eine Kneipenmeile am See Genezareth zum Einkaufsbummel und gemütlichen Ausklang des Tages einluden.
30.5. Der Tag begann mit einem der schönsten Pflichtprogramme, denen man sich in Israel unterziehen kann: dem Pflanzen eines Baumes. Mitten in der kargen Landschaft waren vom Jüdischen Nationalfonds KKL Wasserleitungen verlegt und Pflanzlöcher vorbereitet worden, die unseren Setzlingen das Heranwachsen zu einer Größe ermöglichen sollen, in der sie noch einmal umgepflanzt werden können, um endlich ihren Bestimmungsort im Wald der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu finden. Der Wald ist ein Geschenk der DIG Berlin und Potsdam zum 60. Geburtstag Israels und leistet einen Beitrag zur Aufforstung Israels.
Nebenbei erwies sich unser arabischer Busfahrer als passionierter Teekocher – er bereitete unseren maladen Teilnehmern Salbeitee mit Kräutern, die er am Wegesrand gefunden hatte. Im Anschluss: Besuch der „heiligen Stätten“: Keine Hunde, keine Zigaretten, keine Schusswaffen und keine zu knappe Bekleidung – das sind die Forderungen der Hüter der Heiligen Stätten des Christentums im Heiligen Land: in Kapernaum wirken beispielsweise die Franziskaner – mit einer modernen Kirche, die sie wie ein Raumschiff über die archäologische Ausgrabungsstätte platziert haben, direkt neben den Resten der Synagoge, die als ein Ort gilt, an der Jesus einst predigte. Die Brotvermehrungskirche war am Sonntag leider geschlossen, dafür durften wir einen Rundgang durch die Kirche der Seligpreisungen samt Anlage machen und genossen einen wunderschönen Panoramablick über den See Genezareth.
Auf dem Weg nach Jerusalem folgte ein Besuch im Beit Eyal im Kibbuz Ashdod Yaakov, wo uns Orna Schimoni empfing – eine Frau mit bewegender Biographie, der man ihre 68 Jahre nicht ansah. Ihre Energie wurde freigesetzt durch einen Schicksalsschlag, der sie am 18. September 1997 traf: Ihr jüngster Sohn Eyal wurde im Libanon getötet, als eine Rakete seinen Panzer traf. Bereits im März des Jahres war sie Augenzeugin eines Massakers geworden, als sie mit der Schulklasse ihrer Enkeltochter in Naharayim unterwegs war, der so genannten Friedensinsel zwischen Jordan und Jarmuk. Der jordanische Grenzpolizist Mussa Mustafa lief Amok, er feuerte mit seinem Maschinengewehr auf eine Schulklasse und tötete sieben Mädchen. Drei weitere wurden schwer verletzt. Statt des ursprünglich von ihr geplanten Friedensparks errichtete Schimoni ein Denkmal – ohne auf Genehmigungen zu warten. Für jedes der sieben Mädchen ein in ihren Namenszügen mit Blumen geschmückter Hügel, die sie täglich pflegt, daneben für die Familien ein kleiner Park. Nach dem Schock über den Tod des Sohnes startete sie ihr zweites großes Projekt: Die Errichtung eines Hauses, das seinem Andenken und dem Andenken anderer getöteter israelischer Soldaten gewidmet ist. Das Haus bietet ein Fitnesscenter, das allen Menschen offen steht und behinderte wie nichtbehinderte Menschen zusammenbringen soll. Für die Rehabilitation behinderter Kinder und verwundeter Soldaten zahlt die Krankenkasse, die anderen Gäste müssen einen eigenen Beitrag leisten. Kernstück des Hauses ist eine große Schwimmhalle, die auch für Wettkämpfe geeignet ist. Daneben gibt es ein Studio mit Kraftgeräten, einen Saal für sportliche Betätigung und viele Pläne. Menschen aus der ganzen Region füllen das Haus mit Leben, denn es ist einzigartig im Land. Im Rohbau begriffen ist noch die Wand, die zur Erinnerungsstätte werden soll: es fehlt das Geld für die Gravur der geplanten Tafeln, auf denen die Namen der etwa 2000 Soldaten, die seit der Staatsgründung im Zusammenhang mit den Libanonkriegen gefallen sind, individuelle Zeichen der Erinnerung setzen sollen. Weitere Informationen über das Projekt gibt es im Internet auf der Seite der DIG Berlin https://www.digberlin.de/beit-eyal/ und unter http://www.bet-eyal.co.il/ .
Von diesem Ort, den wir nach dem kurzfristigen Entschluss, dort auch unsere Mittagspause einzulegen, mit einiger zeitlicher Verzögerung dann doch mit gefüllten Mägen verlassen konnten (der Cafeteriabetrieb verlief noch nicht ganz professionell, dafür aber herzlich engagiert) ging es weiter nach Beit She‘an. Von dem 160 Hektar großen Areal des Nationalparks sahen wir nur einen Bruchteil – wir begnügten uns mit einem Spaziergang durch die Überreste der antiken Stadt auf den großen Prachtstraßen, vorbei an den freigelegten Grundrissen von Badehäusern, öffentlichen Toiletten und einem Amphitheater. Die Folgen des Erdbebens von 749 sind noch in situ zu besichtigen: Säulen und Kolonnadenbögen in gleichmäßig ausgerichteten Trümmerhaufen zeugen von der gewaltigen Zerstörungskraft der Erde – ganz ohne menschliches Zutun. Sie wurden so liegen gelassen, wie sie gefunden wurden. Abends erreichten wir Jerusalem und ließen den Tag wieder mit einem kleinen Spaziergang durch die Stadt ausklingen.
31.5. Besuch im Hadassah-Krankenhaus ( http://www.hadassah.org.il/english ). Leider konnten wir die Chagall-Fenster in der Synagoge nicht sehen, da diese gerade einer Renovierung unterzogen wird. Überall herrschte rege Bautätigkeit, dabei ist das Krankenhaus schon eine kleine Stadt für sich: im riesigen Shoppingcenter gibt es Imbissstände, Cafés und von Lebensmitteln über Drogerie- und Modeartikel alles zu kaufen, was man andernorts in einem Einkaufszentrum kaufen kann. Hadassah ist mit etwa 400.000 Mitgliedern die größte Frauenorganisation der Welt. Das Krankenhaus, dessen anderer Teil sich auf dem Mount Scopus befindet, erhält keine staatliche Unterstützung, außer zu Forschungszwecken – so wurde hier etwa ein Operationsroboter entwickelt. Hadassah wird einer Entwicklung der modernen Medizin gerecht: Früher ging man zum Arzt, heute geht man zum Spezialisten. Daher kommen auch Menschen aus Ländern, zu denen Israel bis heute keine diplomatischen Beziehungen hat, um sich behandeln zu lassen. Die Kapazitätsgrenzen sind längst erreicht, das Krankenhaus platzt aus allen Nähten, ein Neubau wurde notwendig: es entsteht ein 19stöckiger Hochhausturm, davon fünf unterirdische Stockwerke mit 20 Operationssälen und 60 Intensivbetten. Seit dem letzten Libanonkrieg gibt es ein neues landesweites Gesetz, das vorschreibt, in jeder Etage eines Neubaus Sicherheitszimmer vorzuhalten. Auch im Krankenhaus muss man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und diese Regelung einhalten; dazu kommt die Verlagerung großer Teile des Krankenhauses unter die Erde um dem hohen Sicherheitsbedürfnis zu entsprechen. Das erklärte Ziel ist allerdings: mit Hilfe der Medizin eine bessere Welt zu schaffen, Verständigung zu ermöglichen: Das Fazit der jahrelangen Erfahrung zeige, dass man im Alltag auch ganz gut ohne Politik leben könne – vielleicht sogar besser: „Man muss sich nicht lieben, aber man soll sich respektieren“, so Anna Agmon, geboren in Köln und seit Jahren zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit von Hadassah , die uns empfing und durch das Gelände führte. Immerhin sind 20% der Bevölkerung Israels Araber, ihre Muttersprache ist arabisch – die zweite offizielle Landessprache. Im Krankenhaus sind die Patienten, anders als oft im israelischen Alltag, nicht getrennt, und so entstehen auch Freundschaften zwischen Israelis und Palästinensern. Das war einer der Gründe, weshalb Hadassah 1995 für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. Allerdings gibt es auch die andere Seite: Traumatisierte, Überlebende von Terror und Bombenangriffen. Für sie gibt es Sozialarbeiter, Ärzte und Volontäre, die selber eine entsprechende Erfahrung gemacht haben und nun anderen helfen, die in einer ähnlichen Situation sind. Während wir die Intensivstation besichtigen, kommt mit einem Mal Hektik auf: Wir müssen gehen, es gab die Meldung, dass mehrere Verletzte eingeliefert werden. Wir werfen noch einen Blick in das Mutter-Kind-Haus, ebenfalls ein riesiger mehrstöckiger Komplex, der an ein Hotel erinnert: luftig und ansprechend gestaltet, ein gläserner Fahrstuhl und bunte Neonleuchten in Tierform. Während wir das Krankenhaus verlassen, hören wir einen Hubschrauber landen und die Sirenen von Rettungswagen. Später erfahren wir, dass es Schwerverletzte der Gaza Flottille Mavi Marmara sind, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Eins der Erlebnisse im Leben, die sich einprägen, und die man nicht so schnell vergisst, wenn man sie von der „anderen Seite“ aus betrachtet.
Eine von denen, die im Hadassah Krankenhaus nach einem Terroranschlag behandelt wurden, war unsere nächste Gastgeberin, Dr. Petra Heldt, evangelische Pfarrerin und Leiterin der Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel (http://www.etrfi.org/). Ursprünglich Berlinerin, arbeitet sie seit rund 20 Jahren in Jerusalem für eine Verbesserung der christlich-jüdischen Beziehungen, u.a. als Dozentin an der Hebrew University. 2005 wurde sie vom damaligen deutschen Botschafter Rudolf Dressler mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Bundespräsidenten ausgezeichnet.
Petra Heldt war gebeten, uns einen Einblick in die Situation der Christen im Heiligen Land zu geben und ging zunächst auf deren rechtliche Situation ein. Während Christen wie Muslime in Israel rechtliche Selbstverwaltung genössen, würden Christen in den palästinensischen Gebieten in den letzten Jahren zunehmend von Muslimen zurückgedrängt. Die Folge: Vor dreissig Jahren lebten ca. 80% Christen in Bethlehem, heute seien es nur noch etwa 5%. Diese Entwicklung sei typisch für die Situation der Christen in muslimischen Ländern im Nahen Osten. Mittlerweile lebten unter der Bevölkerung im Nahen Osten nur noch etwa 1% Christen.
Als aktuelles Beispiel für den Versuch, Einfluss auf Christen zu nehmen, nannte Heldt die von deutscher Seite unterstützte deutsche Schmidt-Schule in Jerusalem (http://schmidtschule.de/). Am Ende des letzten Schuljahres sollte das von radikalen Muslimen das bislang untersagte Kopftuchtragen von radikalen Muslimen eingeführt werden, was bisher verhindert werden konnte.
Heldt betonte, dass es gelingen wird, sich diesem Trend erfolgreich zu widersetzen, wenn man sich auf die eigene Identität besinne und für die eigenen Werte streite.
Als Wissenschaftlerin habe sie sich auch mehrfach mit der vermeintlichen Blütezeit eines interreligiösen Dialogs befasst. Dabei habe sie gelernt, dass Anhänger der Buchreligionen wie Juden und Christen zwar ihren Glauben behalten, jedoch nicht in der Öffentlichkeit ausüben durften. Vielmehr hätten sie bis heute den Status von „Dhimmis“, die einer Reihe von Shariagesetzen unterworfen seien. Zu solchen Gesetzen gehören die Zahlungen verschiedener spezieller Steuern, die oft willkürlich festgelegt werden. Auch hätten „Dhimmis“ aus islamischer Sicht kein Recht auf Land und eigenen Besitz. Von einer Gleichberechtigung der Religionen unter arabischer Herrschaft könne deshalb keine Rede sein.
Petra Heldt berichtete von Forschungsergebnissen des israelischen NGOMonitor Institutes (www.ngo-monitor.org), das bei christlichen Organisationen im In- und Ausland seit längerem eine einseitige pro-palästinensische und anti-israelische Parteinahme nachgewiesen habe. Die NGO-Erklärung am Rande der Durban-Konferenz 2001 hatte zur Delegitimierung Israels beigetragen, wie dies von der Mehrheit der muslimischen Staaten auch im Rahmen der UN versucht werde (http://www.unwatch.org/ ).
Ein Beispiel für eine solche NGO-Organisation sei „Sabeel“, das „Ecumenical Liberation Theology Center“ in Jerusalem (http://www.sabeel.org/). Aus diesem Kreis sei auch das Kairos-Palestine-Paper vom November 2009 erwachsen, das allein Israel als Schuldigen am Nahost-Konflikt ausmache und einen Boykott gegen israelische Produkte vorschlage. Auf dem Evangelischen Kirchentag in München im Mai dieses Jahres sei das Papier ohne kritische Kommentierung verteilt worden, so Heldt.
Am Ende blieben viele Fragen offen. Die Referentin ermutigte, sich nicht von der gegenwärtigen hoffnungslos erscheinenden Perspektive beeindrucken zu lassen, sondern positive Schritte für die Zukunft zu entwickeln. Hierüber sollten wir auf jeden Fall im Gespräch bleiben.
Im Anschluss an diesen nachdenklich stimmenden Vortrag folgte ein Bummel durch die Altstadt, wo wir einer Mischung aus geschlossenen Läden und regem Treiben begegneten. Nach einem kleinen Imbiss besuchten wir die Grabeskirche, in der es – wie immer – von Touristen wimmelte, kletterten aufs Dach zu den Äthiopiern, die sich dort kleine Lehmhäuser unter Pfefferbäumen gebaut haben, in denen sie schon seit Jahren in großer Bescheidenheit leben. Weiter ging es durch die Altstadt, vorbei an historischen Ausgrabungen mit Wandmalereien und Andenkenläden zur Klagemauer. Verhältnismäßig ruhig war es um die israelische Flagge, die dort stolz weht – als Zeichen, wer über das Territorium herrscht. Einlass nur nach Taschenkontrolle wie am Flughafen – eine Prozedur, die man kennt. Warum? Was bedeutet die Klagemauer für Juden? Als vermeintliche Westmauer des alten herodianischen Tempels symbolisiert sie den ewigen Bund Gottes mit seinem Volk. In erster Linie ist sie aber ein Symbol für die Diaspora: „Nächstes Jahr in Jerusalem“ – ein frommer Wunsch – schön, wenn er sich erfüllt. Und ein tradierter Ritus ist es, einen Zettel mit einer Bitte in eine Mauerritze zu stecken. Warum nicht? Glaube versetzt bekanntlich Berge …
Später am Nachmittag erlebten wir eine deutlich angespanntere Stimmung in der Altstadt, die Polizei ist in Dreierpatrouillen mit ihren Maschinengewehren unterwegs, die arabischen Geschäfte sind geschlossen – Generalstreik. Unser Fremdenführer beruhigt uns: das israelische Tourismusamt schickt eine Warnung per SMS, sobald es Erkenntnisse gibt, dass die Situation für uns gefährlich werden könnte. Die „Friedensmission“ der „Gazaflotte“ hatte also einen durchschlagenden Erfolg; viele Händler sind nicht glücklich über den unerwarteten Verdienstausfall und versuchen zaghaft, doch Touristen in ihre (halb) „geschlossenen“ Läden zu locken. Auch wenn die Nerven mal wieder blank liegen, auch wenn mir eigentlich Tel Aviv mehr zusagt als Jerusalem, erst recht bei dieser verhaltenen Stimmung: Die israelische Fahne vor der Moschee ist ein nettes Fotomotiv, und das österreichische Hospiz verkörpert einen Hauch Europa: Nicht nur der wunderschöne Blick über Jerusalem – „Gespendet von der österr. Statthalterei des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem“ entschädigt für viele Strapazen, auch die Wiener Kaffeehauskultur – man spricht selbstverständlich deutsch – und der gemütliche mit reichlich Blumen geschmückte Hof laden zum Verweilen ein – hier lässt es sich leben, und unser Fremdenführer sagt: „Deshalb liebe ich Jerusalem“. Es sind die Oasen, die sich hier und da unerwartet auftun, wie ich sie auch von meinen früheren Besuchen kenne, die Jerusalem zu einer liebenswerten Stadt machen: die Museen, die Parks, die Künstlerviertel und Galerien, das Ticho-Haus, die christliche Jugendherberge YMCA – und eben auch das österreichische Hospiz in der Altstadt, zu der im Sommer regelmäßige Konzerte gehören. Doch zum Verweilen bleibt nicht allzu viel Zeit, wir müssen weiter: eine Katze auf einem heißen Blechdach und mehr Polizeipräsenz bei fast gespenstischer Stille. Die Begegnung mit Avishay Bravermann, MK und Minister für Minderheiten, in der Knesset musste allerdings ausfallen: Bravermann musste wegen der aktuellen Ereignisse die aufgeheizte Stimmung in den arabischen Dörfern schlichten.
Am Abend treffen wir den britisch-walisischen Journalisten Matt Beynon Rees, 1967 geboren und seit 14 Jahren wohnhaft in Jerusalem. Inzwischen hat er ein neues Betätigungsfeld gefunden: Er schreibt Krimis, die spannende Einblicke in die palästinensische Gesellschaft bieten. „Der Verräter von Bethlehem“, „Ein Grab in Gaza“ und „Der Tote von Nablus“ sind inzwischen auch ins Deutsche übersetzt worden. Seine Verbundenheit mit Palästina erklärt Rees damit, dass seine beiden Großonkel in der Britischen Kavallerie waren – im britischen „Imperial Camel Corps“, das 1916 gegründet wurde und in Ägypten gegen Aufständische kämpfte, die sich auf die Seite der Türken geschlagen hatten. Zeugnis dieser Kämpfe sind vier Kriegsfriedhöfe, auf denen die Gefallenen begraben wurden. Ein Onkel kam zurück – und faszinierte Rees mit seinen Erzählungen auf Familienfeiern. Rees kam als Journalist nach Israel, nachdem er fünf Jahre an der Wallstreet gearbeitet hatte. Er kam mit seiner amerikanischen Frau, von der er inzwischen geschieden ist und er blieb – weil ihm die Emotionalität der Reportagen über Menschen mehr liegt als die Zahlen der Finanzwelt. Er ist inzwischen wieder verheiratet und seit kurzem Vater. Sein erster Bericht aus Bethlehem schildert das Schicksal eines Palästinensers, der zu Tode gefoltert worden war – von Arafats Leuten, nicht von Israelis, wie man erwarten würde. Seine Krimis basieren auf wahren Begebenheiten – sie handeln von Alltagsgeschichten, die den effektiv ausgeübten Terror der Intifada vor Augen führen: etwa von einem Mann, der einem kleinen Clan angehörte, der nicht viel Macht hatte und der getötet wurde, um wirkliche Kollaborateure abzuschrecken. Oder Ostjerusalem – wo Israelis unerwünscht sind. Fakten? Arafat hatte für seine drei Millionen Palästinenser mehr Geld zur Verfügung als Deutschland für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Marschallplan – die Hilfe in Palästina kam nie bei den Menschen an und ein großer Teil des Geldes konnte immer noch nicht wieder aufgefunden werden. Korruption ist eines der größten Probleme, das nicht nur auf Arafat begrenzt war und das letztlich zur Wahl der Hamas geführt hat. Trotzdem: Rees setzt sich für einen unabhängigen palästinensischen Staat ein, er glaubt, dass es keine Alternative dazu gebe, als Strukturen zu schaffen, die unabhängig von der israelischen Regierung handlungsfähig seien. Matt Rees (www.mattbeynonrees.com) – ein interessanter und gut informierter Gesprächspartner, politischer als die meisten Krimiautoren, die ich in meinem Leben getroffen habe und engagiert – im festen Glauben an eine bessere Zukunft für Palästina – und für Israel.
1.6. Besuch der Knesset. Wir erhalten eine kleine Einführung in die langen Wege der israelischen Demokratie. Die Knesset hat 12 reguläre Ausschüsse. Dazu kommen außerordentliche Ausschüsse, derzeit sind es vier: Drogenmissbrauch, Kinderrechte, ausländische Arbeitnehmer und der öffentlich tagende Petitionsausschuss. Gesetze entstehen in Israel nicht anders als in Deutschland: sie werden im Plenum gelesen, an die Ausschüsse überwiesen und mit Organisationen und Experten erörtert, auf Finanzierbarkeit überprüft, gegebenenfalls revidiert und abschließend im Plenum beraten. Der Oberste Gerichtshof hat ein „Vetorecht“: Wenn das Gesetz anderen Gesetzen widerspricht, kann es kassiert werden. Dies war beispielsweise der Fall, als das Parlament beschlossen hatte, die Gefängnisse zu privatisieren. Anders als Deutschland hat Israel bis heute keine Verfassung. Es sind lediglich elf Grundrechte definiert. Kernstück ist die Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 (http://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm ). Ein Replikat ist in der Lobby der Knesset neben dem Mosaik gegenüber dem großartigen dreiteiligen Wandteppich zu besichtigen, ein Kunstwerk, das Chagall eigens für das Gebäude entworfen hatte. Der Wandteppich, der Themen der jüdischen Geschichte von der Bibel bis in die Gegenwart aufgreift, wurde in einer Pariser Gobelinmanufaktur gewebt: Israel versteht sich als ein jüdischer Staat – ohne das genauer zu definieren. Die Symbolik spiegelt sich auch im Parlament wider: Die Sitze der Abgeordneten sind in Form einer Menorah angeordnet. Das Parlament besteht derzeit aus 120 Abgeordneten, die 12 verschiedenen Fraktionen angehören. Die größten sind Kadima mit 28 und der Likud mit 27 Sitzen. Es gibt 22 Frauen, vier Drusen – die damit überproportional vertreten sind – und einen Christen. Arabisch als zweite Landessprache darf zwar offiziell gesprochen werden, wird aber selten benutzt. Wer die israelische Politik regelmäßig verfolgt, hat sicher mitbekommen, dass die arabische Abgeordnete der „National Democratic Assembly“ (NDA) Hanin Zoabin an Bord der Mavi Marmara war und dies einen gehörigen Tumult in der Knesset ausgelöst hatte – ein nicht ungewöhnlicher Vorgang; ungewöhnlicher diesmal aber die Konsequenzen: Sie musste ihren Diplomatenpass abgeben und darf das Land nicht mehr verlassen (http://www.welt.de/politik/ausland/article8466227/Gaddafi-provoziert-die-israelische-Marine.html ). Die NDA setzt sich unter anderem dafür ein, dass Israel sich nicht als „jüdischer Staat“, sondern als Staat aller Staatsbürger definiert. Die Wand des Plenarsaals in der Knesset besteht aus Stein aus Galiläa und wurde von dem israelischen Künstler Danny Caravan mit zahlreichen Szenen aus Jerusalem gestaltet. Die Sitzungen der Knesset werden aufgezeichnet und dokumentiert, die Öffentlichkeit ist zwar zugelassen, muss allerdings hinter einem Glasfenster sitzen. Überhaupt sind die Sicherheitskontrollen auch für uns als angemeldete Gäste streng: Es gibt eine Kleiderordnung, alle Taschen und Kameras müssen am Eingang abgegeben werden. Die Knesset ist souveränes Gebiet, sie gehört weder zu Jerusalem noch zum Staat Israel, sondern hat eine eigene Polizei. Nach der allgemeinen Einführung treffen wir Shay Even, seit 2008 Assistent und politischer Berater des Abgeordneten Nitzan Horowitz. Even schätzt an seiner Aufgabe, dass jeder Tag eine unerwartete Herausforderung bringe: von dem kleinsten bis zum größten Problem in der Außenpolitik ist die Palette der Arbeit vielfältig. Die Themenfelder, auf die sich sein Abgeordneter spezialisiert hat, sind Umwelt, Staat und Religion sowie Bürgerrechte. Gerade um die Rechte der Schwulen gibt es ein zähes Ringen: sie sind nicht immer leicht durchzusetzen. Die Partei, der Horowitz angehört, die linke Meretz-Partei, hat nur noch drei Abgeordnete – deshalb muss sie eine Menge Krach machen, um überhaupt gehört zu werden: Die Themen müssen in die Öffentlichkeit gebracht werden, um die Wiederwahl sicherzustellen, so Even. Im Schnitt bringe Horowitz – je nach Thema auch mit anderen Parteien zusammen – einen Gesetzesantrag pro Woche ein. Ein Problem, dem Israel sich gegenüber sieht, ist die Tatsache, dass es unverhofft zu einem Einwanderungsland auch für Nichtjuden geworden ist. Das liegt nicht nur an den Gastarbeitern – besonders aus Thailand und den Philippinen kommen Menschen, die auf dem Bau oder als Krankenpfleger und in der Altenbetreuung arbeiten, sondern auch an den Flüchtlingen aus Darfur – Zehntausende von Menschen seien zu Fuß unterwegs, um über Ägypten und den Sinai in Israel Asyl zu finden – ein Problem, dessen man nicht alleine Herr werden könne und bei dem man letztlich auch auf die Unterstützung aus Europa angewiesen sei. Hierbei handele es sich um eine humanitäre Krise und ein globales Problem, das vor rund 10 Jahren begann und sich inzwischen gravierend verschärft habe. Israel allein habe nicht die Kapazitäten, um nach Schätzungen zwischen 40.000 bis zu einer Million aufzunehmen. Israel habe versucht, den Zugang auf das Staatsgebiet durch Grenzkontrollen zu verhindern. Auf deutscher Seite sei man mit der SPD und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit im Gespräch über mögliche Lösungen. Ein anderes Thema sei die Frage, ob Israel sich künftig als säkularer oder religiöser Staat verstehe. Die Frage müsse besonders deshalb gestellt werden, weil die religiösen Parteien immer mehr an Einfluss gewönnen. Aus der Sicht seiner Partei, die sich als säkular definiere, handele es sich hierbei um die wichtigste Zukunftsfrage in Israel.
Damit entlässt er uns, und wir nutzen die Zeit bis zum nächsten Termin für einen Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, der vor allem deshalb wichtig war, da einige von uns das erste Mal in Israel waren.
Bei unserem Treffen mit einem Vertreter der Nichtregierungsorganisation „Ir Amim“ (Stadt der Völker) für eine Informationstour entlang des Sicherheitszauns/der Mauer verspäteten wir uns durch den Stau nach einer Polizeiabsperrung im Straßenverkehr. Eitan Katz, ein aus Deutschland eingewanderter „Jecke“, ist ein freundlicher älterer Herr, der fließendes, etwas antiquiertes Deutsch spricht. Ich hatte bereits 2004 Gelegenheit, an einer ähnlichen Tour mit dieser Organisation teilzunehmen. Damals war die Kritik weitaus schärfer. Inzwischen bezweifelt niemand mehr den Nutzen des Grenzzauns, die Kritik richtet sich nur noch an einigen wenigen Stellen gegen die Grenzziehung, und auch hier scheint es inzwischen zu pragmatischen Lösungen gekommen zu sein. Ulrich Sahm schreibt in seinem Buch „Alltag im Gelobten Land“: „Bakaa ist ein arabisches Dorf nördlich von Tel Aviv. 1949 wurde es durch die Waffenstillstandslinie geteilt. Nach 1967 wuchs es wieder zusammen. 2003, beim Bau des Sperrzauns, zogen die Israelis den Ostteil des Dorfes auf die israelische Seite, wie es die Dorfbewohner und arabisch-israelische Abgeordnete forderten. Es kam zu einer internationalen Verurteilung Israels. Daraufhin wurde der Grenzzaun des Dorfes demontiert. Eine Mauer wurde mitten durch Bakaa gezogen. …Israel wurde gelobt, sich an das Völkerrecht gehalten zu haben. … Wenn es um vermeintliches „Recht“ geht, interessiert sich niemand mehr für das Schicksal der betroffenen Menschen.“ Wir besichtigen einen Olivenhain, den ebenfalls das Schicksal der Trennung von seinem Eigentümer ereilte. Nach einer Klage vor dem Obersten Gerichtshof, den „Ir Amim“ unterstützt hatte, kann der Besitzer den Grenzzaun nun ohne Probleme passieren, seinen Hain versorgen und die Früchte ernten. Eine Nachricht ohne Nachrichtenwert, die keinen interessiert. Für mich war erstaunlich, wie sich die Sichtweise bei „Ir Amim“ in nur wenigen Jahren so grundlegend ändern kann: Israel ist sicherer geworden. Es gibt keine Selbstmordattentäter mehr. Kein Wunder, dass alle Bemühungen, diesen Status quo, den niemand für einen erstrebenswerten Dauerzustand hält, wieder zu ändern, mit großem Zögern verbunden sind. Die Häuser in Grenznähe, besonders die Siedlungen, gleichen kleinen Festungen, sie erinnern eher an Burgen als an Ortschaften.
Am Abend dann noch eine Diskussionsrunde mit dem israelischen Journalisten Gad Lior und dem Mitbegründer des israelischen Journalismus“,Ari Rath, geboren in Wien, zum Thema „Die augenblickliche Stimmung in Israel“. Im Zentrum des Gesprächs standen selbstverständlich die aktuellen Ereignisse um die Gaza-Flotte. Essen, Strom, Medikamente, Wasser – alles sei im Gaza-Streifen vorhanden, so Lior. Allerdings dürften Frauen nicht mehr studieren. Außerdem schikanierten die Terroristen die Bevölkerung. Seiner Meinung nach könne Israel die Grenze trotzdem nicht öffnen, denn es komme nach wie vor zu Raketenbeschuss. Gerade heute habe es wieder fünf Tote gegeben, drei davon waren Palästinenser, die in Gaza versucht hatten, eine Rakete abzuschießen. Das blutige Entern der Mavi Marmara bezeichnete er als „Fiasko ersten Grades“: neun Tote, fünfzig Verletzte, davon 15 israelische Soldaten – eine selbst verschuldete Katastrophe, die durch eine Untersuchungskommission geklärt werden müsse, so beide Referenten. Eindeutig sei, dass die Armee den politischen Auftrag gehabt habe, die Landung zu verhindern. Dass es eine Lösung des Konflikts und Frieden geben müsse, sei allen Beteiligten bereits seit zwanzig Jahren klar, in Friedensverhandlungen habe es auch immer wieder Vorschläge dazu gegeben, wie eine Lösung aussehen könne. Gad Lior aber stellt die Frage: „Wie viele Tote wird es noch geben, ehe die Politik sich dazu durchringen kann? Derzeit sehe es danach aus, als strebe die Hamas statt einer Zweistaaten- eine Dreistaaten-Lösung an.
Rath ergänzte, dass der Teilungsplan vom November 1947 nicht nur gerecht, sondern auch pragmatisch gewesen sei und die Araber damals einen Fehler begangen hätten, ihn abzulehnen. Im Sechs-Tage-Krieg hätten sie die Hälfte an Land verloren. Die Pläne für Jerusalem sähen nun eine internationale Enklave vor, die von der Zweistaatenlösung ausgenommen werden solle. Sein Fazit: Beide Seiten müssen auf ihre politischen Träume verzichten. Alle Pläne für eine Lösung lägen vor (Genfer Initiative) und auch die Mehrheit der Bevölkerung auf beiden Seiten plädiere für eine Zweistaatenlösung.
2.6. Der letzte Tag war noch einmal der Kultur und zudem der Erholung gewidmet. Wir starteten mit einem atemberaubend schönen Blick auf Jerusalem – Halt am Fotopunkt auf dem Ölberg mit Blick über die Altstadt mit der goldenen Kuppel des Felsendoms. Anschließend begann der Ausflug ans Tote Meer: durch die arabischen Teile Jerusalems, die ebenfalls stark im Wachsen begriffen sind, vorbei an den Bergen der judäischen Wüste, wo links und rechts der Hauptstraße die Beduinen ihre Zelte aufgeschlagen haben, zur „Route 90“, die das Land von Nord nach Süd durchquert. Von Jericho geht sie durch die Westbank am Toten Meer entlang. Wir halten in Qumran, ein weiterer israelischer Nationalpark: hier wurden in den fünfziger Jahren hebräische Schriftrollen gefunden, die den Essenern zugeschrieben werden, auch wenn dies von einigen Wissenschaftlern schon in Frage gestellt wird. In den achtziger Jahren wurden die Höhlen touristisch erschlossen, es gibt heute einen einführenden Film, ein kleines Museum und bei einem Rundgang über die Ausgrabungen kann man die heute unzugänglichen Eingänge zu den Höhlen sehen. Anschließend hielten wir in Mizpe Shalem, wo die Kosmetikfirma Ahava angesiedelt ist und Produkte aus dem Salz und Schlamm des Toten Meeres hergestellt und verkauft werden. Wir lassen den Werbefilm über uns ergehen– selbstverständlich auf Deutsch – und decken uns mit den Produkten ein – ab einem Wert von 400 Schekel wird die Mehrwertsteuer am Flughafen erstattet, das ist deutlich günstiger als die Preise in Berlin oder im Internetversand. Danach durften wir gleich gegenüber und mit einem Gutschein für die Badeanlage ausgestattet, das Tote Meer einmal selbst ausprobieren – eine Wohltat für die Haut und Entspannung pur innerhalb von 1 ½ Stunden inklusive Mittagspause. Das Tote Meer ist mit einem Salzgehalt von etwa 33% der am tiefsten gelegene See weltweit (unter 400 Meter unter dem Meeresspiegel – unbedingt ausprobieren, solange es noch existiert: Derzeit verdampft es mit einer rasanten Geschwindigkeit, der Pegel sinkt seit den 80er Jahren jährlich um etwa einen Meter. Die Landschaft ist von beeindruckender Schönheit, Sand und türkisfarbene Salzseen erfreuen die Augen durch karge Schlichtheit.
Die letzte Station unseres umfangreichen Programms ist die Festung Massada – gelegen auf einem einsamen Berg zwischen Totem Meer und Judäischer Wüste. Die Botschaft, die mit den Überresten dieser Festung verbunden wird, ist allerdings ambivalent: der Historiker Flavius Josephus berichtete, dass die Belagerten lieber als freie Menschen sterben als den Römern in die Hände fallen wollten nach dem Motto „Ein ruhmvoller Tod ist besser als ein Leben im Elend.“ Die Festung, im Wesentlichen von König Herodes erbaut, wurde im Verlauf des jüdischen Krieges gegen die römischen Besatzer im Jahr 66 eingenommen und von knapp tausend Juden besiedelt. Der Rest der Geschichte ist weniger amüsant: Nur sechs Jahre später marschierte Rom mit 15.000 Mann an und belagerte die Festung. Als die Lage für die Juden aussichtslos wurde, beschlossen die Bewohner, lieber kollektiven Selbstmord zu begehen als sich in die Sklaverei zu begeben. Sie zogen das Los, wer als letztes sterben sollte. Über lange Jahre in Vergessenheit geraten, wurde die Festung 1838 wiederentdeckt, seit 1948 dient sie als zionistisches Symbol. In den sechziger Jahren grub der israelische Archäologe Jigael Yadin große Teile der Festung aus – ihm ist das neue Museum gewidmet, das die Geschichte in einer Audiotour erläutert – selbstverständlich auf Deutsch und mit eindrucksvoller musikalischer Untermalung. Moshe Dayan prägte in der israelischen Armee den Schwur „Massada darf nie wieder fallen“, weshalb jahrelang dort Vereidigungen israelischer Soldaten stattfanden. Die Symbolik scheint mir fatal und und fast sieht es so aus, sie treibe den Staat Israel in eine sich selbsterfüllende Prophezeiung. Dabei war er als ein Zeichen des Selbstbehauptungswillens angesichts einer großen Übermacht gedacht. Inzwischen wird diese Symbolik deshalb auch differenzierter betrachtet – denn wer will schon den Selbstmord, wenn er leben kann? Die Erinnerung jedoch bleibt und ist im nationalen Mythos verwoben und sie wird auch immer wieder neu belebt. Inzwischen ist Massada behindertengerecht und bequem mit einer Seilbahngondel zu erreichen, der weite Blick über die judäische Wüste und das Tote Meer bleibt atemberaubend, es weht die israelische Flagge und ein Aberglaube besagt, dass die Festung jüdisch bleibt, solange die Rabenvögel dort leben. Sie sind handzahm, haben sich freudig vermehrt und mögen die Touristen ganz offensichtlich. Massada ist wie die Altstadt von Akko in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Heute bietet die Ruine der Festung auch eine faszinierende Kulisse – während unseres Aufenthaltes wurde etwa mit großem Aufwand eine Aufführung der Oper Nabucco inszeniert.
Am Abend trafen wir den israelischen Pressefotografen David Rubinger, geboren 1924 in Wien, der eine Auswahl seiner Bilder zeigte, die die Staatswerdung Israels und die israelische Politik seit nunmehr über sechzig Jahre dokumentieren. Ein würdiger und kurzweiliger Abschluss für eine Reise, die auf Grund des sehr intensiven Programms viel zu schnell vorbei gegangen war.
Ein großes Dankeschön geht dafür an Meggie Jahn von der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft Berlin-Potsdam, die das Programm so vorzüglich organisiert hat. Schalom und auf Wiedersehen nächstes Jahr in Jerusalem.
Dr. Nikoline Hansen