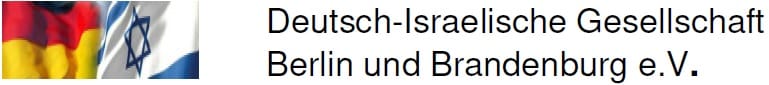Die Juden waren Opfer, sie wollen es nie wieder sein. Und nun, in der Auseinandersetzung mit dem Iran, fühlt sich Israel allein gelassen. Ein Bericht aus einem bedrohtem Land.
von Stephan-Andreas Casdorff
Die Straßen sind uneben. Steine, die nebeneinander liegen, als hätten sie eben erst Verbindung zueinander aufgenommen, verlangsamen den Schritt. Auf und ab gehen die Straßen, Gerüche durchziehen sie, jeder wie eine Aufforderung, ihm zu folgen, ihn zu ergründen, alles riecht nach Leben. Die Klagemauer ist nicht mehr weit, noch eine Treppe, ein Platz, eine Taschenkontrolle entfernt. Dieses Jahr in Jerusalem, diese Woche, dieser Tag. Das ganze Land erinnert sich seiner Helden und seiner Opfer. Es hält inne, hält still für den Moment, um sich zu versenken in vergangenes Leid, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Seelisch.
Israel in dieser Zeit.
Die Sonne brennt, der Wind kommt eisig kühl hinterher, der helle Sandstein lässt die Hügel der Stadt Jerusalem leuchten. Besuchergruppen durchströmen sie, aus allen Ländern, nicht laut, nicht leise, die Sprachen verschmelzen, wenn sie auf engen Gassen einander begegnen, sich mischen, sich wieder trennen und auseinander streben. Orthodoxe Juden begegnen ihnen allen, das Stadtbild ändert sich, sie wirken dominant, schwarz-weiß gekleidet, die Hüte groß wie die Selbstverständlichkeit, in der sie ihren Platz auf der Straße einfordern. Sie rücken vor und nehmen ein, Restaurants, Straßenzüge. Aufmerksamkeit folgt ihnen.
Eine Veränderung ist zu greifen. Das Traditionelle lebt, das auch, aber es ist das politische Leben, das es begleitet in dieser hochpolitischen Stadt. Benjamin Netanjahu, der Premierminister, hatte gerade seinen palästinensischen Amtskollegen zu Gast. In der Apartheid wäre das nicht passiert, so reaktionär war der konservative Netanjahu nie. Der Rassismus Südafrikas sah auch anders aus. Sigmar Gabriel hat einen schnellen Eindruck von seinem Besuch in Ramallah niedergeschrieben, einen flüchtigen dazu, und einen bleibenden hinterlassen. Die Menschen hier haben gelernt, nicht zu vergessen. Sie zu versöhnen, ist eine lang währende Aufgabe.
Es ist nicht, dass sie keinen Frieden wollten, ihn nicht halten wollten in der Regierung Netanjahu. Das ganze Land, das ganze kleine Land, weiß doch, was das heißt: Frieden. Und was Krieg bedeutet. Darum laufen junge Männer in Uniform mit Maschinengewehren und scharfer Munition durch die Straßen, verweilen sie auf Plätzen, lachend, feixend, entspannt auf steinernen Bänken vor der goldenen Menorah, dem Leuchter, der dermaleinst wieder auf seinen Platz im großen Tempel gelangen soll, wenn der wieder steht, und wenn alle Bitten, die in die Ritzen der westlichen Mauer des Tempelbergs, der Klagemauer, versenkt wurden, Wirklichkeit geworden sind.
Frieden kann es geben, auf ewig, würde auch Netanjahu sagen – wenn das Recht seines Landes auf Existenz von den Nachbarn, den arabischen, palästinensischen, anerkannt wird. Ein für alle Mal. Wenn keiner der Nachbarn mehr den „Staat der Zionisten“ von der Landkarte auch der Geschichte tilgen will. Ganze neun Kilometer ist Israel an seiner schmalsten Stelle breit.
Wenn da nicht so viel anderes zu hören wäre. Von den nahen Nachbarn und den fernen, aus dem Iran. Auch, nein, gerade in Israel wird jedes Wort genau gehört, wird in Gesprächen nach dem Eindruck des Gastes gefragt, wie ernst die Situation denn aus seiner Sicht sei. Jobwechsel werden storniert, Umzüge auch, in Haifa oder Tel Aviv zu leben, wenn das unvorstellbar Vorstellbare eintritt – nein, das doch lieber nicht, nicht jetzt. Die Menschen richten sich ein, in dieser Zeit, in diesen Umständen.
Sie warten. Gespannt und angespannt, nehmen alle Informationen zur Lage auf, analysieren sie. Nicht nur die in der Regierung, in den Streitkräften oder Geheimdiensten. Israel in seiner Lage: Was von Beobachtern für Gewohnheit gehalten wird, für schiere Anpassung an die Situation, ist doch ein Zustand an Aufmerksamkeit, der Kraft kostet: die Kraft, sich zu beherrschen, aber nicht sich beherrschen lassen. Nicht von Angst, aber auch nicht von anderen, die denken, sie wüssten es besser.
Die Shoah ist gegenwärtig
Gerade erst hat Netanjahu sich mit Barack Obama gestritten. Er wirft ihm vor, und das längst nicht mehr nur hinter geschlossenen Türen, sich dem Thema Iran und dessen Streben nach nuklearer Macht nicht genug zu widmen, es nicht entschieden genug zu behandeln. So wirkt es – in Israel, auf Israel -, als hätte der amerikanische Präsident sich zu beschwichtigen entschieden. Die nächste Runde der Gespräche mit dem Iran über das Atomprogramm soll erst Ende Mai stattfinden. Ein Freifahrtschein für den Iran, findet Israels Premierminister, und ein Ticket ins Unglück für sein Land. Der Iran baut weiter seine Anlage. Er soll sogar schon Atomzünder getestet haben.
Obama war, das wissen die kundigen Israelis genau, vor kurzem in der kleinen Stadt Darwin in Australien, und die Rede, die er dort hielt, wurde allgemein als strategische Neuorientierung verstanden. Hier erst recht. Da passt es ins Bild, dass Netanjahu schon lange, sehr lange freundschaftliche Kontakte zu Mitt Romney unterhält, Harvard-Absolvent wie auch er, der Obama soeben vorwarf, „Israel unter den Bus zu werfen“. Das klingt wie das, was in Israel zu hören ist. Und das ist eine Veränderung, eine spürbare.
Jahrzehnte, in denen das offizielle Amerika nie einen Zweifel daran gelassen hat, wie es um das Verhältnis steht und dass es fest an der Seite Israels steht, regiere es, wer will. Jetzt regieren Spannungen, so sehr, dass Israel den USA vorhält, es dürfe nie wieder geschehen, was im vergangenen und doch allgegenwärtigen Jahrhundert passierte; dass zunächst trotz aller Hinweise, trotz des weitgehend gesicherten Wissens seit Juni 1942, nichts geschah. Schon mehr als drei Millionen Juden waren damals ausgelöscht worden. Yad Vashem, die Gedenkstätte, die auch Schulungsstätte ist, in die Kinder von der 10. Klasse an kommen, in die auch die höchste Generalität, sogar der Generalstabschef zum Lernen und Vertiefen der Kenntnisse kommen, legt davon Zeugnis ab: Juden waren Opfer. Sie wollen es nie wieder sein.
Geschichte ist ein Geflecht von Entscheidungen, sie ist nicht Determination, daran erinnert Noa Mkayton von der Gedenkstätte. Sie hat in Deutschland studiert und leitet den deutschsprachigen Desk an der Internationalen Schule für Holocaust-Studien. An das Vergangene zu erinnern, hilft beim Bewältigen der Zukunft. Die Shoah, der Holocaust, definiert sich so: als der „Plan zur totalen Vernichtung des jüdischen Volkes und der Mord an den Juden, die von den Mördern nicht erreicht werden konnten“. So sagte es Yehuda Bauer 1998 im Deutschen Bundestag.
Und die Shoah ist gegenwärtig in diesen Tagen. 40 Prozent der Israelis im Alter von 15 bis 85 Jahren halten den Holocaust prinzipiell für jederzeit wiederholbar. Vor allem den Jüngeren ist es unvorstellbar, dem wehrlos zu begegnen, sich wie „Schafe zur Schlachtbank“ führen zu lassen. Mögen viele Traumata auch nicht aufgearbeitet sein, wie Mkayton sagt, Traumata wie die ersten Kriege, die Israel um seine Existenz führte: das Leben in Dilemmata, die existenzielle Entscheidungen erzwingen, lehrt sie die Shoah, über die Grenzen der Generationen hinweg. Nicht nur am Gedenktag fliegen die israelischen Fahnen an den Masten entlang der Straßen. Dass sie heute auf Halbmast wehen, ist die Mahnung
Das „selber Schuld“, das in vergangenen Jahren in Israel mitunter denen entgegen gerufen worden ist, die die Unterdrückung, Entrechtung und den Versuch der Entmenschlichung in Europa im vorigen Jahrhundert überlebt haben, ist immer noch lebendig. Es zeigt sich in dem „Nie wieder“, das bis hinein reicht in die Reden des Premierministers. Geschichte ist ein Geflecht von Entscheidungen, nicht determiniert, lehrt der pädagogische Ansatz von Yad Vashem; der politische ist, dass Israel sich nicht auf Hilfe verlassen kann, sondern auf sich selbst verlassen will. Verlassen können will – und muss.
Darum spricht Netanjahu so, seit Monaten, Wochen, am Gedenktag. Er zieht die historische Linie vom Iran mit dessen Atomplänen zum Holocaust, weil er nicht will, dass einer wie Gabriel Bach, der einst der Ankläger von Adolf Eichmann war, später wieder erzählen kann, wie sich in den 60er Jahren junge Israelis schämten, nicht hören wollten, nicht verstehen konnten, dass sich so viele abschlachten ließen. Heute sollen sie ihr Schicksal ihrer selbst bewusst bestimmen.
Vom arabischen Frühling zum Sommer der Stabilität
Der Staat Israel kam zehn Jahre zu spät, um den Holocaust zu verhindern, argumentieren sie in der Regierung Netanjahus und seiner Partei, dem Likud; aber jetzt, da er existiert, können seine Entscheidungen die Wendepunkte in der Geschichte bestimmen. Wenn Zehntausende Raketen der Hisbollah aus dem Libanon im Land einschlagen können, dann soll klar sein, dass kein Schlag einfach hingenommen wird. Heute wollen, was eine dramatische Veränderung in der Gesellschaft ist, 80 Prozent der Israelis eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern, auch die „Falken“ vergangener Tage, die Hardliner. Aber 80 Prozent sind zugleich skeptisch, weil nicht klar ist, wer für die Palästinenser steht. Angebote sind gemacht, weitreichende, aber es ist die Entscheidung der anderen, sie anzunehmen. Wie im Fall Iran.
Jetzt, da in der Region erstmals Werte wie Demokratie, Offenheit, Wahlfreiheit in ungeahntem Maß gefordert worden sind, sollen aus dem Arabischen Frühling Sommer der Stabilität werden. Nicht einmal der Mossad, der Geheimdienst Israels, wusste, was im arabischen Raum geschehen würde. Ist das nicht die Chance eines Geflechts an Entscheidungen, die Geschichte machen können?
Wenn da nicht diese Anomalien wären. Die Araber gingen auf die Straße, ihre Slogans waren westliche Werte, Wahlen kamen, und gewählt wurden die, die mit Gott Politik machen. Gott ist zurück in der Politik. Gott macht aber keine Kompromisse. Und so zeigt sich die nah- und mittelöstliche Welt, von Palästina bis in den Iran. Die PLO ist eine Bewegung mit nationalem Ziel, die Hamas ist eine religiöse, und die hat die meisten Stimmen. Im Iran gehen Menschen auf die Straße, aber es herrschen weiter die Mullahs. Es ist gewiss eine Frage der Perspektive, aber aus der Nähe betrachtet, aus Israel, sieht es aus wie eine Bedrohung.
Sie sehen die Chancen schon auch, die auf strategische Allianzen. Mit den Saudis, nehmen wir sie als Beispiel. Ein Bündnis zur Abschreckung: Die Saudis wünschten sich, dass Israel gegen den Iran vorgeht. Denn nie haben sie wegen des Staates Israel die Atomwaffe angestrebt; nie, obwohl seit Jahrzehnten vermutet wird, dass Israel diese Waffe hat. Bis zu 200 nukleare Gefechtsköpfe, wie das Londoner Institut für Strategische Studien sagt, mit Trägerraketen, die den Namen „Jericho“ tragen. Aber wenn der Iran die Atomwaffe haben sollte, mit der er den Staat Israel von der Landkarte tilgen kann, was das Regime der Schiiten unverändert als Ziel beschreibt, dann wollen die sunnitischen Scheichs in Saudi-Arabien sie auch.
Die Sanktionen gegen Teheran wirken, ziemlich beeindruckend findet das ein Teil der Regierung in Jerusalem. Der Iran ist nicht Nordkorea, kann nicht autark leben; und mit den Russen an der westlichen Seite wären die Sanktionen noch stärker. Diese Allianz muss, wie auch das Geschehen in Syrien zeigt, nicht nur geschmiedet, sondern gehärtet werden
Gehärtet sind hingegen die Allianzen Israels über Jahrzehnte, doch in diesen Tagen wird ihre Haltbarkeit getestet. Haben die USA nicht schon einmal nicht eingegriffen, als sie es hätten tun können? Haben sie nicht schon einmal die Hinweise nicht ernst genug genommen? Da nutzen die Zusagen von bunkerbrechenden Bomben und Tankflugzeugen und Tarnkappenjagdbombern kaum, zumal die F-35 erst in zwei Jahren eintreffen. Israel fühlt sich allein gelassen.
Dieser Tag, er steht unter dem Motto: „Meines Bruders Hüter – jüdische Solidarität während des Holocaust“. Die Sicherheitsvorkehrungen beginnen weit im Vorfeld; Agenten des Shin Beth warten auf die Besucher. Die gesamte Staatsspitze ist in Yad Vashem erschienen. Der Präsident spricht, der Ministerpräsident auch, die Obersten Rabbis Israels sprechen Psalme und Kaddish, der Chefkantor der Streitkräfte singt, ein Corporal stimmt zum Abschluss die Nationalhymne an. Sie singen lauter als der scharfe, eiskalte Wind. Eine Gruppe junger Elitesoldaten steht in Habacht-Stellung. Und es leuchten sechs Kerzen für sechs Millionen ermordete Juden, die sechs Überlebende entzündet haben. Einer von ihnen ist in Berlin geboren.
Da fällt ein Grass-Gedicht nicht wirklich ins Gewicht.
Den Originalartikel finden Sie im TAGESSPIEGEL vom 22.04.2012