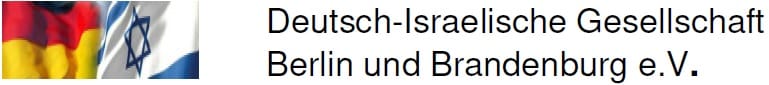Wir danken Sigalit Meidler von der Jüdischen Volkshochschule Berlin sehr herzlich für das Angebot zur Kooperation bei dem spannenden Abend mit Elvira Grözinger in einem wunderbaren Ambiente. Der Jüdischen Gemeinde ist zu danken, dass sie extra für diese Veranstaltung die Öffnungszeit der ihrer Bibliothek verlängerte.
Im folgenden dokumentieren wir eine von der Autorin gekürzte Version ihres Vortrags bei Jüdischer Volkshochschule und DIG Berlin und Potsdam am 3. Dezember 2009. Wir danken ihr für die Erlaubnis zur Publikation. Frau Margrit Schmidt danken wir für die Fotos.
Was hat es mit dem Begriff „Sfaradim“ – auch „Spaniolen“[1] – genannt, wirklich auf sich?
Dieser Begriff wurde bis vor einigen Jahren für alle nicht-aschkenasischen, d.h. aus Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa stammenden Juden verwandt, also auch für diejenigen, die aus dem Orient stammten, wiewohl die eigentlichen Sepharden die Bewohner der Iberischen Halbinsel waren, die von dort 1492 (aus Spanien) und 1531 (aus Portugal) vertrieben wurden.
Sie ließen sich in Nordafrika (insbesondere Marokko), dem Osmanischen Reich, Südosteuropa (Bulgarien, Griechenland), Nordeuropa (Hamburg, Amsterdam), in Frankreich, England und sogar in Amerika oder Indien sowie teilweise im restlichen Afrika nieder. Außer den Sfaradim gibt es die arabischen, bzw. orientalischen Juden, die sich Misrachim nennen. Diese Juden waren – wie die sephardischen Juden – irgendwann aus Judäa und Galiläa dorthin ausgewandert bzw. wurden von dort exiliert.
Sie haben also gemeinsame Wurzeln, kulturell jedoch haben sie sich unterschiedlich entwickelt und ihren jeweiligen Mehrheitsgesellschaften angeglichen. Da das Osmanische Reich von ca. 1299 bis 1923 existierte und sich in Kleinasien, im Nahen Osten, auf dem Balkan, in Nordafrika und auf der Krim ausbreitete, gab es zwischen den Sfaradim und den Misrachim ebenfalls fließende Grenzen. Das wird auch z. B. durch die Gründung eines neuen „Klubs der sephardischen Frauen“ in Berlin bestätigt, dem jüdische Frauen angehören, die hauptsächlich aus dem Kaukasus, der ehemaligen Sowjetunion, stammen und einen iranischen Dialekt, genannt „Gouri“, sprechen.

Als Juden aus den arabischen Ländern 1948 nach Israel einwanderten, waren die wichtigen Positionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft schon von den Aschkenasim besetzt. Diese von den Alteingesessenen nicht ganz präzise genannten „Sepharden“ fühlten sich daher benachteiligt, gehörten mehrheitlich der „unteren“ sozialen Schicht an. Bis heute sind sephardische und orientalische Juden in politischen Ämtern, Führungspositionen und in der Literatur des Landes immer noch unterrepräsentiert. Doch langsam gewinnt diese – lange von den aus West- und Ost-Europa eingewanderten Juden verachtete – Minderheit an Beachtung. Selbstbewusst erobert sie neue Positionen, und wie alles im israelischen Alltag, so spiegelt sich auch diese Entwicklung in der heute spannenden Literatur des Landes wider.
Ob es ein sephardischer Schriftsteller wie A. B. Yehoschua ist, dessen Familie aus Griechenland stammt und seit fünf Generationen in Israel ansässig ist und die Geschicke der sieben Generationen der Familie Mani in dem Roman Die Manis, mit einem ähnlichen Hintergrund schildert, oder die Tochter persischer Einwanderer, die in Israel geborene Dorit Rabinyan, die das orientalisch geprägte Leben der jüdisch-persischen Frauen in ihren Romanen Die Mandelbaumgasse oder Unsere Hochzeiten beschreibt. Diese Literatur unterscheidet sich in ihrer Thematik, Metaphorik und ihrem Lokalkolorit erheblich von derjenigen der aus Ost- und Mitteleuropa stammenden israelischen Autoren und Autorinnen.
Vom Leben der irakischen Juden in Bagdad und später, nach 1948, als vom israelischen aschkenasischen Establishment vielfach an den Rand gedrängte Neueinwanderer und Flüchtlinge aus den arabischen Ländern erzählen die aus dem Irak eingewanderten Schriftsteller Sami Michael und Eli Amir.
A. B. Yehoschua und „seine Manis“ wie auch die nicht aschkenasischen Autoren und Helden der anderen Romane und Erzählungen verkörpern das, was man seit einigen Jahren „yam tichoniut“ nennt, die Mediterranäität Israels, die mit der wachsenden kulturellen und gesellschaftlichen Entfernung von der dort früher vorherrschenden aschkenasischen hin zur mediterranen Lebensform, angefangen von den Bräuchen, über die Musik, bis zur Küche, einhergeht.
Wie gesagt, von den Sfaradim zu unterscheiden sind die Misrachim, Juden aus dem heute arabischen Orient. Wie z. B. Sami Michael und Eli Amir in ihren Romanen beschreiben, wurden die Flüchtlinge aus dem Orient in Israel anfangs in armselige, eilig errichtete Zeltstädte (Ma’abarot, temporäre Ansiedlungen) einquartiert und später zum Städtebau abkommandiert.
Damals gab es noch keine Konzepte für eine Integrationspolitik in Israel. Ihre Eingliederung in den Kibbuzim scheiterte oft am Widerstand der Alteingesessenen, vor allem der Aschkenasim aus Osteuropa. Es scheiterte auch die Ansiedlung in den Moschawim (Landwirtschaftskooperativen), vor allem, weil die meisten Misrachim Handwerker und Kaufleute ohne landwirtschaftliche Erfahrung waren. Die Misrachim unterschieden sich in noch höherem Grad als die Sfaradim von den Aschkenasim, was die Assimilation in die israelische Gesellschaft zu einem schwierigen und jahrzehntelangen Prozess machte. Soziologen haben zahlreiche Faktoren ausgemacht, welche die Integration beeinträchtigten, darunter den Ausbildungsgrad vor der Ankunft im Land. Das änderte sich natürlich im Lauf der Jahre, denn der Bildungsgrad stieg und die Mischehen von Aschkenasim und Misrachim in Israel, die anfangs auf sehr große Vorbehalte auf beiden Seiten stießen, sowie der allgemeine Gebrauch des Hebräischen haben so nachhaltig unter der jungen Generation gewirkt, dass Neuankömmlinge wie etwa Russen und Äthiopier die Misrachim inzwischen für einen Teil des israelischen Establishments halten.
Wohl lag 2004 das Durchschnittseinkommen der Aschkenasim immer noch um 36 Prozent höher als das der Misrachim, aber dieser Unterschied wird mit der Vermischung der Gruppierungen geringer. Dass viele von ihnen wie auch der Sfaradim immer noch zu den ärmeren Schichten zählen, zeigt der Roman von Sara Shilo, Zwerge kommen hier keine.[2] Heute wollen die Sfaradim nicht zu den Misrachim gezählt werden, wiewohl es bei den oft verwickelten Schicksalen der Juden auf Wanderschaft in der Diaspora schwer zu unterscheiden ist, wer was ist. Wir werden das auch bei manchem unserer heutigen Autoren und Autorinnen sehen. Sepharden sind auch unter den deutschen Juden zu finden, die sich als die Aschkenasim per excellence verstehen – auch Heinrich Heine z.B. hatte sephardische Vorfahren …
Die moderne israelische Literatur ist ungeheuer reich, vielseitig, interessant und beunruhigend zugleich. Ihr Reichtum beruht in großem Maße auf dem multikulturellen Hintergrund ihrer Schöpfer. Ein „melting pot“ wie Israel ist geradezu dazu prädestiniert Werke hervorzubringen, die in ihrer kulturellen Vielfalt kaum eine Parallele haben, zumal die israelischen Ethnien sehr zahlreich sind: Neben den erwähnten gibt es die Gruppe der Juden aus dem Jemen und Äthiopien sowie kleinere Gruppen in Süd- und Ostasien (vor allem Indien und China) sowie aus Afrika südlich der Sahara.
Noch bis vor kurzem herrschte die Meinung vor, dass Juden in den arabischen Ländern nicht verfolgt wurden, ihre Situation nicht mit den Pogromen Osteuropas verglichen werden kann und sie schon gar nicht mit dem Horror der Shoah konfrontiert wurden. Das sieht man inzwischen anders und weiß, dass auch die sephardischen Juden – wie etwa 1944 die aus Saloniki Deportierten – Opfer der Shoah waren, und man weiß, dass die Juden aus dem Irak, aus Ägypten und so weiter, die dort seit Jahrtausenden lebten, Verfolgungen erlitten hatten, die sie zur Flucht zwangen.
Die Romane der Schriftsteller aus dem Irak erzählen von dem „Farhud“, dem Pogrom des Jahres 1941 in Bagdad, als 180 jüdische Männer und Frauen brutal ermordet und 240 verletzt wurden. Wenigstens zwei andere Pogrome kennt man aus der Geschichte der irakischen Juden – 1776 in Basra und 1828 in Bagdad.
Dorit Rabinyan lässt die Politik weitgehend außen vor und schreibt sehr „weiblich“ – ihre Heldinnen sind meist Frauen, die in der männerdominierten Gesellschaft im häuslichen Bereich ein enges, mühsames Dasein fristen, früh heiraten, Kinder bekommen und von ihren Männern verprügelt werden. Ihre Männer bekriegen sich untereinander, zeigen sich gelegentlich aber auch solidarisch. Als allwissende Autorin beschreibt Dorit Rabinyan die Frauen in ihrer Körperlichkeit, beinahe voyeristisch, als ob die Leser die Frauen im Bad, dem Hamam, heimlich beobachten und ihren geheimsten Wünschen und Träumen zuhören würden. Brutalität, Aberglaube, Unwissenheit, Neid und Missgunst regieren in den beengten Wohnverhältnissen, wo jeder über jeden alles weiß, wo es keine Geheimnisse, Intimsphäre und kein Entkommen gibt.
Es ist ein Pandämonium im echten Sinne des Wortes, dennoch voller verführerischer Farben, Geräusche und Düfte wie auch schrecklicher Gerüche – typisch Orient -, der anziehend und abstoßend zugleich wirkt, welcher aber so anders als z. B. das vertraute Bild des osteuropäischen Schtetls ist. Zwar sind beide jüdische Welten – die okzidentale und die orientalische – ähnlich armselig, doch die Kleidung (z. B. der Tschador), die Küche (z. B. die Pitateig-Zubereitung auf dem Fußboden), die Bräuche und Gebräuche unterscheiden sich sehr stark voneinander. Der muslimische Einfluss auf die Juden war enorm und tangierte sogar das Ritual und den Gottesdienst der Synagoge.[3] Der Leser merkt: Die orientalischen Juden sind ihren nichtjüdischen Nachbarn viel ähnlicher als die osteuropäischen Juden den ihren. Das macht diese Literatur für die nicht-orientalischen Leser umso faszinierender, denn man wird in eine fremde, exotische Welt eingeführt.
Die Hintergrundmusik für die Familiensaga im Roman Viktoria[4] von Sami Michael, der 1936 in Bagdad geboren wurde und 1949 nach Israel einwanderte, ist die unsichere Existenz der Juden in Bagdad, damals unter türkischer Herrschaft. Angefangen vor dem Ersten Weltkrieg, spiegelt der Roman den Zerfall des Osmanischen Reiches, die Entstehung des modernen Irak 1920/21 aus den drei osmanischen Provinzen Bagdad, Mossul und Basra, das Erstarken des irakischen Nationalismus und somit der Judenfeindschaft. Er erzählt auch die Geschichte der kommunistischen Untergrundaktivitäten, die britische Okkupation, den Zweiten Weltkrieg samt den Pogromen an der jüdischen Bevölkerung sowie die Gründung des Staates Israel und die Emigration der Familie dorthin.
Schonungslos beschreibt Michael die Atmosphäre in der Enge des Ghettos, voller Aberglauben, Gewalttätigkeit und Mitleidlosigkeit, eine Gesellschaft, in der die Männer brutal das Sagen, und Frauen keine Rechte hatten. Viktoria, Tochter der Nadzhija und des Clanführers Izuri, wächst in der Enge des armen Judenviertels, neben den zahlreichen freundlich und feindlich gesonnenen Verwandten auf, die sich in ihren Bräuchen und ihrer Kleidung (Schleier) kaum von den moslemischen Nachbarn unterscheiden, aber ihre Sprache, „der jüdische Akzent“ und ihre Religion sind anders.
Diese Gesellschaft verändert sich allmählich, indem bei den Männern westliche Bildung und Kleidung Einzug halten und die Familien aus den ärmeren in die reicheren Viertel ziehen. Schließlich wird das Leben in Israel kurz angedeutet – zunächst in den Übergangslagern, dann in der eigenen Wohnung, doch zu Hause kann sich die ältere Generation dort nicht mehr fühlen. Da die Frauen Analphabetinnen sind, des Hebräischen nicht mächtig, sind sie isoliert und träumen von ihrem alten Leben in Bagdad. Viktorias Söhne, die in Israel aufwuchsen, machen ihr später Vorwürfe, dass sie nicht haben studieren dürfen. Das Gefühl der Benachteiligung der orientalischen Juden auch in der israelischen Gesellschaft wird hier angesprochen.
Auch in den teilweise autobiographischen Romanen Der Taubenzüchter von Bagdad[5] und Nuri. Vom Irak ins Land der Väter[6] von Eli Amir, der 1937 in Bagdad geboren wurde und 1950, mit 12 Jahren, nach Israel emigrierte, wird das Leben der Juden in Irak und als Flüchtlinge in Israel thematisiert. Eli Amir, Akademiker und politischer Berater der israelischen Regierungen, wie Sami Michael, ein bekannter Schriftsteller und selbst Teil des Establishments. Beide Autoren haben erreicht, was vielen Einwanderern ihrer Generation nicht gelungen war, dennoch prangern sie die Fehler der israelischen Integrationspolitik an, die in den Gründerjahren des Staates aufgrund der aschkenasischen Überheblichkeit versagte, mit nachhaltigen Folgen.
Etliche der irakischen Juden, die in ihrem Geburtsland wohlhabend und respektiert waren, wiewohl stets auf das Wohlwollen der islamischen Obrigkeit angewiesen, wurden bei der Ausreise gezwungen, ihr Hab und Gut zurück zu lassen, und mussten nun, enttäuscht und mittellos, auf schmerzliche Weise auch noch von ihrem zionistischen Traum Abschied nehmen. Das hat auch die Zukunft ihrer Kinder vielfach beeinflusst bzw. verbaut. Es war vielfach das Potential vorhanden, nur hatten nicht alle die Chance, ihr Ziel zu erreichen, und nicht alle waren in der Lage, die großen Hürden zu überwinden. Deshalb sind die meisten dieser orientalischen Neueinwanderer auf der unteren sozialen Stufe geblieben und so ist die israelische Gesellschaft in dieser Hinsicht auch heute noch nicht frei von Spannungen. Obwohl seit her Vieles für die Integration der Neueinwanderer getan wurde und man– ob in den Kibbuzim oder Schulen – aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, gibt es noch immer viel zu tun. Das fordert auch der Roman Sara Shilos Zwerge kommen hier keine.
Wie anderswo sind alleinerziehende Frauen in Israel die Leidtragenden. Die Heldin des Romans, Simona Dadon, ist eine Witwe mit sechs Kindern, die in einem nordisraelischen Entwicklungsstädtchen wohnt, in dem die meisten Einwohner orientalische Juden sind, die unter dem Raketenterror aus dem Libanon leben müssen. Nach dem plötzlichen Tod des Familienoberhaupts und Ernährers folgt der soziale Abstieg der aus Marokko stammenden Frau, die ein primitives, fehlerhaftes Hebräisch spricht, in dem auch der Roman verfasst wurde. Simona trauert, ihre Familienwelt ist in eine Unordnung geraten, die jener im Norden Israels im Kriegszustand entspricht, – es herrscht Angst und Verwirrung, alles gerät aus den Fugen.
Sara Shilo, irakisch-syrischer Herkunft, hat hier eine Figur erschaffen, die autobiographische Züge trägt und die ihr alter ego hätte sein können, wenn die Autorin nicht ein Gymnasium in Rehavia, dem „deutschen“ Viertel ihrer Heimatstadt Jerusalem besucht hätte, wo sie sich fremd fühlte und sich bemühte, ihren arabischen Akzent und die gutturale Aussprache zu verlieren, die auf ihre orientalische Herkunft hinwies. Zwerge kommen hier keine, ihr erster Roman für Erwachsene, gewann mehrere Preise, bis hin zur Israels höchster literarischer Auszeichnung. Shilo lebt mit Mann und 5 Kindern in Galiläa. Sara Shilos Figuren gehören der Bevölkerungsschicht an, der in der israelischen Literatur bisher kaum eine Stimme geschenkt wurde. Das wird naher Zukunft sicher anders werden.

[1] Cf. Spharadim-Spaniolen. Die Juden in Spanien bis 1942. Die sephardische Diaspora, Studia Judaica Austriaca, Bd. XIII, Hrsg. Felicitas Heimann-Jelinek u. Kurt Schubert, Eisenstadt 1992.
[2] Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, DTV 2009; Hebräisch: Shum Gamadim lo Yawou“, `Am `Oved 2005.
[3] Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press 984.
[4] Aus dem Hebräischen von Inken Kraft, btb,1997, Hebräisch Viktoria,`Am `Oved,1993,S.13;15;80 f.,42.
[5] Aus dem Englischen von Karina Of, Petra Post und Andrea von Struve, Lübbe 1998; Hebräisch: Mafriach hayonim, `Am `Oved 1992, S. 301, 622f., 625,
[6] Übersetzung Lore Hartmann-von Monakow, Zürich 1988; Hebräisch: Tarnegol kaparot (Sühneopferhahn), `Am `Oved 1983, S.173, 241.