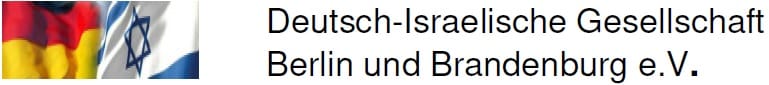Sie waren Kriegsgegner und wurden Freunde. Nun reisen der israelische und der jordanische General in ihre Vergangenheit und zeigen, wie wichtig solche Beziehungen für Israel sind, während die Revolten in der arabischen Welt alte Gewissheiten zerstören.
Dem General geht es schlecht. Seit gestern ist das Stechen da. Vielleicht nur eine Verspannung, ein Muskelziehen. Aber nun blickt der General besorgt. Er will nicht, dass seinetwegen angehalten wird. Seine rechte Hand folgt dem Schmerz tastend bis an die Brust.
„Bist du müde, General?“
„Es geht mir gut.“
„Brauchst du eine halbe Stunde, um zu beten und dich auszuruhen?“
„Seit gestern schmerzt mein Arm.“
„Dein Arm, General?“
„Ja, der linke. Kam in der Nacht.“
„Wir müssen dich untersuchen lassen. Nimmst du deine Pillen noch?“
Zwei Männer in einem Auto. Ein Jude, ein Muslim. Sie fahren durch den Norden Galiläas, zu Orten, an denen der Israeli und der Araber einander töten wollten.
Sie waren Kriegsgegner, heute sind Baruch Spiegel und der Jordanier Mansour Abu Rashid Freunde. Sie reden sich gegenseitig mit General an, denn das sind beide, hochrangige Offiziere ihrer Armeen, wenn auch nicht mehr im Dienst. Jetzt suchen sie einen Arzt.
„Das ist eine ernste Sache“, sagt Baruch Spiegel. Der 63-Jährige hat scharfe Augen, die den anderen Mann auf der Rückbank unnachgiebig mustern. Er greift zum Telefon. Er wird einen Doktor ausfindig machen. Trotz des Streiks, in den die Ärzte in Israel an diesem Tag getreten sind. Das ist nicht nur eine Frage der Gastfreundschaft.
In den meisten Nachbarländern des jüdischen Staates ist die Situation so angespannt wie nie. Die Entmachtung von Präsident Mubarak, das Bündnis von Hamas und Fatah und die anhaltenden Unruhen in Syrien. Sogar in Amman ist der Ruf nach Reformen des politischen Systems laut geworden. Israel weiß nicht mehr, was es erwarten kann.
„Der Frieden wackelt“, hatte am frühen Vormittag ein Fremdenführer im ehemaligen Wohnhaus von David Ben Gurion in Tel Aviv gesagt. Forsch hatte der kahlköpfige Mann mit dem harten Gesicht eines Jagdfliegers die Erwartung beiseite gewischt, dass Israel eigentlich aufatmen müsste, jetzt, da die arabischen Staaten sich der einzigen parlamentarischen Demokratie im Nahen Osten auch politisch annähern. „Die Religiösen werden an die Macht kommen.“ Der Mann stand vor einer Wand mit Fotos. Sie zeigten den stets munteren, weißhaarigen Staatsgründer Ben Gurion als großväterliche Erscheinung, ein Enkelkind an der Hand. Schulklassen kommen hierher für ein wenig Zuversicht. „Sehen sie“, sagte der Fremdenführer mit französischem Akzent, „Männer in meinem Alter haben in diesem Land mindestens zwei Kriege erlebt. 1967 und noch einmal sechs Jahre später. Wenn der ägyptische Oppositionspolitiker Mohammed El Baradai jetzt verkündet, man werde es sich nicht bieten lassen, dass Israel den Gazastreifen noch einmal angreife, ist klar, was von den ägyptischen Demokraten zu halten ist.“
In dem Auto des Israeli und des Arabers fahren dieselben Sorgen mit. Ist der „kalte Frieden“ mit Ägypten sicher? Steht er nur auf dem Papier? Was, wenn mehr Demokratie nur zu mehr Islamismus führt? Es sind Fragen danach, worauf man sich in der Krise noch verlassen kann.
Die mögliche Antwort führt den Juden und den Araber zunächst zu den Golan-Höhen. Die sind in Nebelschleier getaucht. Als wollte Syrien, das dahinter liegt, verbergen, wie es derzeit in seinem Inneren aussieht.
General Mansour, ein Herr von 65 Jahren mit gütigen nussbraunen Augen, einem dünnen Schnauzbart und zurückhaltenden Bewegungen, will das auch verbergen. Er wehrt sich gegen die Fürsorge des Anderen. In Haifa gebe es einen Arzt, sagt dieser. Haifa ist weit.
Die beiden Generäle haben etwas zu sagen
Was die beiden Männer verbindet, ist selten im Nahen Osten. Sie wissen es selbst. Es gibt etliche Friedensaktivisten unter Israelis, Palästinensern und Arabern. Sie stoßen gemeinsame Projekte an, sie meinen es gut, aber meistens haben sie nichts zu sagen. Die beiden Generäle hatten etwas zu sagen. Auch einander. Bis heute ist das so. Spiegel ist hinter den Kulissen als Berater einer Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit tätig, und Mansour betreibt in Amman ein kleines Friedenszentrum. Vor ein paar Stunden ist er an einer Kreuzung bei Afula in diesen japanischen Mittelklassewagen gestiegen, um an einer Reise in die Vergangenheit des Israeli teilzuhaben. Sie wollen erzählen, wie aus Feinden Freunde werden konnten. Es geht zu den Orten, an denen alles angefangen hat. An denen es aber auch beinahe vorbei war.
Wie in dem Hain am Fuß der Golan-Höhen, in dem die beiden Ex-Militärs an einem frühsommerlichen Tag aus dem Auto steigen. Vor 44 Jahren liegt ein damals 18-Jähriger an derselben Stelle auf seinem Marschgepäck und wartet auf Befehle. Sein Wehrdienst bei einer Eliteeinheit hat gerade erst begonnen. Granaten der syrischen Artillerie schlagen in den umliegenden Feldern und in einem nahen Kibbuz ein. Es gibt Tote. Aber Verteidigungsminister Mosche Dajan zögert. An der Grenze zu Ägypten und im Westjordanland rücken israelische Truppen bereits vor. Aber sollen sie sich auch mit Syrien anlegen? Der junge Baruch Spiegel kann die Stellungen des Feindes an den grünen Hängen sehen, er brennt darauf loszuschlagen. Heute sagt er über sich: „Ich war bereit, zu geben.“
Spiegel ist im Juli 1948 in Italien geboren worden, in einem Flüchtlingslager, als Sohn galizischer Juden, die den Holocaust überlebt hatten und auf die Überfahrt nach Israel warteten. Es seien einfache Leute gewesen, sagt Baruch Spiegel, ihre Familien von den Nazis ausgelöscht. 1967 glauben sie, dass auch ihr Sohn getötet worden ist. In der Straße, in der die Spiegels leben und aus der drei Jungs eingezogen worden sind, machen Gerüchte von hohen Verlusten die Runde.
Zur selben Zeit ist für Leutnant Mansour Abu Rashid der Krieg bereits vorbei. Die Israelis haben seine Einheit am zweiten Kriegstag in der Nähe von Jerusalem umzingelt und festgesetzt. Der Offizier gilt als Kriegsgefangener. „Aber der General ist geflohen“, sagt Spiegel über den weißhaarigen Mann, der in seiner dünnen Wolljacke fröstelnd neben ihm steht und bei diesen Worten die Schultern hebt, als sei die Flucht ein Versehen gewesen. „Unsere Artillerie hatte Anweisung, eigene Stellungen zu beschießen, sobald die in Feindeshand fielen, da mussten wir weg.“
Drei Tage irren er und seine Kameraden in der Westbank umher. Der Rückzug ist ihnen abgeschnitten. Sämtliche Brücken über den Jordan sind gesprengt. Am Ende zählt die Armee König Husseins 7000 Tote, Verwundete und Vermisste. „Wir respektierten die Jordanier als harte Krieger“, sagt Spiegel. „Sie waren nicht weggelaufen. Das half sehr, als wir später mit ihnen verhandelten.“ Wer sich so ins Zeug legte, dem war leichter zu trauen.
Spiegel jagt die Serpentinen hinauf zu den Ruinen der früheren syrischen Befestigung. Nur verschüttete Tunnel und überwucherte Steinmauern sind übrig geblieben. Auf einer Tafel stehen die Namen der Gefallenen. Spiegel deutet in die Landschaft unter sich. Trotz der niedrigen, zerfransten Wolkendecke ist die Ebene von Kiryat Shmona weit zu überblicken. Die schlammigen Feldwege sind dieselben wie damals, und Baruch Spiegel lässt sie mit dem Zeigefinger noch einmal von seiner früheren Kompanie befahren, erzählt schwer atmend, wie sich der Tross an einer Weggabelung verirrt und direkt ins feindliche Feuer gerät. Spiegel selbst und sechs weitere Rekruten kauern flach auf der Ladefläche eines gepanzerten Lastwagens. Kugeln prasseln in die Abdeckung, als sie auf die gegnerische Stellung zufahren. Ihr Anführer wird durch einen Kopfschuss getötet. Auf sich allein gestellt dringen sie in die Bunkeranlage ein. Die syrischen Offiziere sind fort, die verschreckten Mannschaften sitzen in einem Verlies fest. „Sie hatten sie dort eingesperrt und den Schlüssel weggeworfen“, erinnert sich Spiegel, „das war ein Schock für mich.“
Der Sechs-Tage-Krieg 1967 ist der erste Konflikt, der Baruch Spiegels Plan, Mediziner zu werden, durchkreuzt. Er beginnt ein Studium, aber schon bald wird er zu seiner Einheit zurückgerufen. „Mit meinem zivilen Leben, bin ich nicht vorangekommen. Ich habe praktisch die ganze Zeit gekämpft, bis ich General wurde.“ Einmal durchschlägt ein Querschläger seine Wange. Er lässt sich den Bart stehen, um die Narbe zu verbergen. Ein andermal, 1982, da ist er bereits Kommandant, verfolgt er Terroristen in unwegsames libanesisches Gelände hinein, als die Kugel eines Hisbollah-Scharfschützen ihn in der Brust trifft. Sie zertrümmert sein Fernglas und reißt ihn meterweit nach hinten. Das Blut spritzt aus der Wunde, doch bleibt das Projektil zur Hälfte in der Schutzweste stecken. Sprechen kann er nicht, er muss Steine in Richtung seines Funkers werfen, damit der aufhört, seinen Tod zu melden.
„Meine Schwester, eine Psychologin, meint, dass die Erfahrungen meiner Eltern in Buchenwald und Auschwitz mich in die Armee getrieben haben. Und da ist etwas dran. Nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973, bei dem wir wirklich um unsere Existenz fürchteten, fühlte ich mich unter Offizieren sicherer als unter Zivilisten“, sagt Spiegel.
Wie konnte aus ihm dann ein Wegbereiter des Friedens werden? „Als es nötig war, aggressiv zu sein, war ich aggressiv. Als ich nachgiebig sein musste, war ich auch das.“
General Mansour hat eine ähnliche Formulierung für seinen Sinneswandel parat. „In der Armee kann man nicht ,Nein’ sagen“, erklärt er, „außer, man findet eine Entschuldigung.“
Aber dass es um Pflicht geht, ist nur die halbe Wahrheit. Mansour Abu Rashid entstammt einer einflussreichen Familie aus Amman. Er selbst besuchte die Polizeiakademie, bevor er sich entschloss, dem Vorbild seines verehrten älteren Bruders zu folgen und in die Armee einzutreten. „Ich hatte nie das Gefühl ein ,junger Mann’ zu sein“, sagt er, „vom ersten Tag an gab ich alles, um Verantwortung zu übernehmen und die Nummer eins beim Militär zu werden.“ Er sollte Chef des Nachrichtendienstes, Sicherheitsberater des Königs und Vater von sieben Kindern werden. Und der Bürgerkrieg 1970 ihn prägen, bei dem König Hussein die PLO aus ihren jordanischen Hochburgen vertrieb, doch ein Sieg war das nicht. Es nagte an Mansours Stolz, dass sein Land seine Grenzen nicht dicht bekam. Dass es von Terroristen immer wieder für Angriffe auf Israel genutzt und ihm die Schuld daran gegeben wurde.
In rasender Fahrt lenkt Baruch Spiegel den Wagen zu dieser Grenze. Er war Oberbefehlshaber der hier stationierten Golani-Brigade, er kennt den Weg an Militärbasen, an abgesperrten Minenfeldern und einer altertümlichen Ölpipeline vorbei. Die Straße ist von Panzerketten aufgerissen und auf der „Israel Touring Map“ der Autovermietung gar nicht verzeichnet. „Ich hätte meine eigene Karte mitbringen sollen“, raunzt Spiegel und drückt aufs Gas. Seine Entschlossenheit hat ihn stets höher geführt. „Baruch, wir fliegen!“, stöhnt es vom Rücksitz.
Als Yitzhak Rabin Spiegel Anfang der 90er Jahre zum Leiter des Liaison Office machte, gab es nur wenige Männer, die mehr Feldzüge in der der Israel Defence Force (IDF) erlebt hatten. Doch nun musste er, der wortkarge Mann, vollkommen umdenken. Er wurde zu einem Überredenskämpfer. „Ich sollte die Interessen meiner Regierung durchsetzen, aber niemand sagte mir, wie ich das ohne Waffen anstellen sollte.“
Der erste Golfkrieg war gerade vorüber, der Zusammenbruch des Ostblocks stellte viele arabische Länder vor eine neue Situation. Rabin sah darin eine „historische Gelegenheit“, die 550 Kilometer lange Ostgrenze seines Landes zu Jordanien dauerhaft zu befrieden. Spiegel wurde vorgeschickt, warum ausgerechnet er, kann sich der hagere Veteran noch immer nicht erklären. „Ich habe stets versucht, mich aus der Politik herauszuhalten, und bin die Dinge pragmatisch angegangen“, sagt er. Vielleicht war das der Grund.
Einen Plan gab es 1992 nicht, es war nicht einmal klar, wie er über die Waffenstillstandslinie hinweg Kontakte zu den Nachbarn knüpfen sollte.
In einer engen Schlucht eben südlich des Sees Genezareth unterhielt die UN einen Grenzposten. Hier wurde der Wasserpegel eines Zuflusses des Jordans und Quell ewigen Streits reguliert. Hier gab es eine Brücke. Und von den Straßen oberhalb des schmalen Wasserlaufs war der Übergang nicht einzusehen. Für Spiegels Vorhaben ein idealer Ort. Auch jetzt, als er den Wagen im knirschenden Kiesbett neben einem stark befestigten Grenzzaun zum Stehen bringt, ist von der Stelle der ersten Begegnung tief unten im Canyon nichts zu erkennen.
„Ich hatte eine Avocado mitgebracht. Die kanntest du nicht“, sagt Spiegel.
„Stimmt, heute bauen wir sie auch an.“
Drei Sekunden, und er wusste, sie würden klarkommen
Bis dahin hatten sich Israelis und Jordanier bestenfalls ignoriert, oft sogar in Scharmützel verwickelt. „Ich wusste nach drei Sekunden“, sagt Mansour, „dass ich mit ihm auskommen würde.“
Ein Foto, das bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung zwei Jahre später in der Negev-Wüste von Rabin, Bill Clinton und König Hussein aufgenommen wurde, zeigt am Bildrand auch die „Architekten“ des Friedensabkommens. Ein Furcht einflößender Kämpfer mit Vollbart, Fliegerbrille und braunem Barett auf dem Kopf der eine; der andere ein untersetzter Herr im senffarbenen Dress der jordanischen Armee. „Ohne persönliche Zuneigung klappt es nicht“, sagt Baruch Spiegel. „Wir konnten nach jedem Zwischenfall das Gespräch wieder aufnehmen.“
Rückschläge gab es oft. Die Unübersichtlichkeit des Tals bot auch Terroristen von Arafats PLO Unterschlupf. Immer wieder kam es zu Angriffen auf Zivilisten. Die Jordanier wussten diese Schleichkommandos auf ihrem Terrain nicht zu unterbinden. Aber sie begannen, israelische Patrouillen am anderen Flussufer mit verschiedenfarbigen Signalraketen zu warnen. Bald gab es keine Attacken mehr, dafür Mobiltelefone und spezielle Nummern, unter denen sich Spiegel und Mansour jederzeit erreichen konnten. Und dann war da noch die Sache mit dem Wolf.
General Spiegel erzählt sie auf dem Weg entlang des Jordans. Sie handelt von einer Wissenschaftlerin der Universität Tel Aviv, von einem Jäger und einem Halsband. Das hatte die Tierforscherin einem Wolf umgebunden, um dessen Wanderungsbewegungen zu studieren. Als der Jäger das Tier erlegt, funkt es unbekümmert weiter. Spiegel soll die Sonde wieder beschaffen. Er wendet sich an Mansour. Bis dahin war es bei ihren Treffen um Wasserquoten und Luftkorridore gegangen. Die Wissenschaftlerin erklärt Mansour, wie die Sonde funktioniert, welche Daten sie speichert, und dass Tierkundler diese Informationen brauchen. Er verspricht, sich der Sache anzunehmen. Ein Tag verstreicht, ein zweiter, schließlich eine Woche, ohne dass etwas geschieht. Nur die Sonde hört nach drei Stunden auf zu piepen.
Zehn Tage später ein Zeichen von Mansour. Sie fliegen zum Treffpunkt. Aus seinem Aktenkoffer holt der Araber zwei Halsbänder. Auch ein älteres, nach dessen Verbleib sich drei Jahre zuvor niemand zu erkundigen gewagt hatte. „Ich dankte ihm vielmals“, erzählt Spiegel, „aber dann fiel mir auf, dass irgendetwas mit dem Gerät nicht stimmte. Man hatte es aufzubrechen versucht.“
Es sei kein Problem gewesen, den Sender zu finden, meldet sich Mansour von hinten und kurbelt das Seitenfenster etwas herunter. „Ich wollte ihn sofort wieder zurückgeben.“ Doch das Hauptquartier in Amman hat Sorge. Die Juden könnten die Wölfe als Spione über die Grenze geschickt haben. Mansour versichert, dass er die Juden kenne, und dass die lediglich mehr über die Wölfe erfahren wollten. Am Ende muss König Hussein entscheiden, was mit dem Halsband geschehen soll. „Dadurch erfuhren andere Generäle zum ersten Mal von den geheimen Unterredungen mit Israel“, fährt Mansour fort. Und Spiegel, der nie auch nur lächelt, lacht auf. In einer gänzlich zivilen Angelegenheit war ein Erfolg erzielt worden. Das hieß doch auch, dass Fehler nicht mehr als hinterlistige Manöver der Gegenseite betrachtet wurden, sondern als etwas, das man aus der Welt schaffen konnte. „Das war der Durchbruch.“
Aber was Friedensverhandlungen so kompliziert macht, sind die Details. Jeden einzelnen Kilometer Grenzland haben Spiegel und Mansour überprüft. Der UN-Beschluss von 1948 sah die Flussmitte des Jordans als Staatsgrenze vor. Eine einfache Regelung. Aber für das Wasserkraftwerk von Naharayim mussten sie sich trotzdem etwas besonderes einfallen lassen.
Beim Blick in alte Dokumente fiel den beiden Generälen nämlich auf, dass Jordanien auch ein Teil des Landes zustand, der seit Generationen von einem jüdischen Kibbuz bewirtschaftet wird. Man kann die Felder des Kibbuz sehen von der Anhöhe aus, auf die die beiden Männer im Abendlicht steigen, um ihr Meisterstück zu begutachten. Denn hier, an dieser Flussbiegung, haben sie ein Paradigma des Nahen Ostens gebrochen, wonach der Besitz von Land wichtiger ist, als der Nutzen, der aus ihm gezogen wird. Gleichzeitig sind sie hier auch gescheitert. Vielleicht wollten sie zuviel.
General Spiegel sagt jetzt deshalb nichts. Er möchte, dass General Mansour es erklärt. Aber gerade da klingelt sein Telefon. Die Familie ist besorgt. Schon Mansours Vater, ein Onkel und ein Bruder sind an Herzinfarkten gestorben. Haifa sei nicht mehr weit, beruhigt er sie. Aber zuerst müsse er noch erklären, welch clevere Idee sie hier hatten, wo sich der Grenzfluss in einen Nebenarm verzweigt, wo es alte Staubecken, Schleusentore, Dämme und Betonrinnen aus den 20er Jahren gibt und in ihrer Mitte eine Insel, jordanisches Territorium, von Israelis kultiviert.
Die Lösung, finden die beiden Generäle, sähe so aus: Von Sonnenaufgang bis -untergang erhalten die israelischen Bauern freien Zugang zu ihren Felder. Ein Weg führt hinüber. Das Tor steht offen. Israel gibt damit Land an einen anderen Staat ab, obwohl es weiterhin Ansprüche daran knüpft. Und es funktioniert.
Aus dem Friedenspark wird ein furchtbarer Irrtum
Es funktioniert zunächst sogar sehr gut. Aber dann greifen die alten mörderischen Mechanismen. Wieder. Aus dem, was sie „Friedenspark“ taufen, weil sich die Menschen hier treffen dürfen, wird ein furchtbarer Irrtum.
Unter arabischen Israelis ist der „Friedenspark“ sofort der Renner. Sie kommen in Scharen, um sich hier mit ihren Verwandten aus Jordanien zu treffen, die sie viele Jahre nicht gesehen haben. Und während Mansour das erzählt, wird das Erzählen beinahe wichtiger als die Geschichte selbst. „Wissen Sie“, der General zögert, „Araber sind so: Sie brauchen bald einen besseren Anlass, um sich wiederzusehen. Also fangen sie an, Handel zu treiben.“ Tabak ist in Jordanien sehr billig, in Israel teuer. Die Menschen schmuggeln Zigarren und Zigaretten. „Aber wir sagten uns, lasst sie doch.“
Bis eine jordanische Streife einen Sack mit Kalaschnikows, Munition und Pistolen auf dem Gelände findet. Es stellt sich heraus, dass die Waffen für arabische Klans in Kafr Kana nahe Nazareth bestimmt sind, um dort eine Fehde auszutragen. Daraufhin wird lediglich Reisegruppen noch gestattet, in Bussen zur anderen Seite zu pendeln. Am 13. März 1997 hält ein solcher Shuttle-Bus mit israelischen Schulkindern unweit des jordanischen Wachturms. Als sie aussteigen, werden sie von einem Grenzsoldaten beschossen. Sieben Mädchen sterben im Kugelhagel.
Warum? „Man könnte sagen, ein verrückter Kerl“, sagt General Mansour und seine freundliche Stimme beginnt, sich zu sträuben. „Wir verhörten ihn. Er hatte viele Entschuldigungen. Keine beruhte auf Fakten. Einmal sagte er, die Mädchen hätten ihn mit ihren nackten Beinen provoziert. Aber es waren Schülerinnen“, bricht es aus dem General hervor. „Zwölf bis 15 Jahre alt. Dann wieder sollen sie den Koran verhöhnt haben. Dabei dürften sie kaum gewusst haben, wie das geht.“
Die Reise des Juden und des Arabers hat auf diesen Ort und seinen Schatten zugesteuert. Und Baruch Spiegel ist froh, dass sein Freund ihn erklärt hat. Andersherum hätte leicht eine Anklage daraus werden können. „Es war ein großer Schock damals“, sagt Spiegel. Der Friedenspark, in Blut getaucht. „Trotzdem“, sagt Spiegel, „hat es hier etwas gegeben, das zum Modell für einen Frieden mit den Palästinensern werden könnte – die Möglichkeit, Land zu tauschen.“
In der Notaufnahme des Krankenhauses in Haifa herrscht Hochbetrieb. Mansour wird auf ein Bett gelegt. Sein Blut tropft in Ampullen. Er wird geröntgt und sein Herzschlag gemessen. Spiegel weicht nicht von seiner Seite, redet mit Ärzten, schafft Schwestern herbei. Es ist wie immer. Er kümmert sich, knüpft Kontakte, bezieht immer mehr Menschen mit ein.
Auch zu ägyptischen Offizieren habe er gute Beziehungen unterhalten, damals, als IDF-Verbindungsmann, erzählt er. Manchmal brachten sie ihre Frauen zu den regelmäßigen Treffen mit. Aber einen Tag nach der Versetzung auf einen anderen Posten, brach der Kontakt immer ab. „Selbst zu Leuten, mit denen man sich gut verstanden hatte“, sagt Spiegel. Über die Gründe kann er nur spekulieren: die Überwachung der Sicherheitsapparate, die Mentalität. Der Frieden sei wohl mehr eine Pflicht. Könnte sein, dass sie den Ägyptern auch wieder lästig wird.
Als Mansour Abu Rashid spät in der Nacht wieder aufstehen darf, weil nichts gefunden wurde in seinem Blut und an seinem Herz, liest Spiegel ihm den Entlassungsbrief vor. „Sie hätten dich am liebsten noch dabehalten“, sagt er, „Du darfst gehen, weil ich ihnen versprochen habe, dass du zuhause zu einem Arzt gehen wirst. Das tust du doch, Basha?“
Lesen Sie den Artikel von Kai Müller im TAGESSPIEGEL vom 11.05.2011.