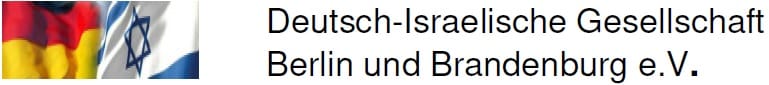Bericht zur Israelreise der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Arbeitsgemeinschaft Berlin und Potsdam vom 15. bis 24. Mai 2016
von Reiseleiterin Maya Zehden
stellv. Vorsitzende DIG Berlin und Potsdam
25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich angemeldet, eine große Zahl angesichts der zahlreichen Messerattacken von Palästinensern auf israelische Passanten.
Gleich nach der Ankunft am Abend in unserem Jerusalemer Hotel und einem schnellen Abendessen besuchte uns der ehemalige Berliner Arye Sharuz Shalicar, der heute als Armeesprecher der ZAHAL für den deutschsprachigen Raum tätig ist. Schon sein Lebensweg ist interessant, darüber hat er das Buch „Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude“ geschrieben. Seine Ausführungen zur aktuellen Sicherheitslage Israels mit den arabischen Nachbarn waren hoch spannend. Die Gruppe hatte mit diesem Reiseauftakt einen guten Start.

Tag zwei begann mit einem Besuch bei Friends of Roots, einer lokalen palästinensisch-israelischen Initiative, einem seltenen Beispiel für die Zusammenarbeit von jüdischen Siedlern mit ihren palästinensischen Nachbarn für Verständigung in Gush Etzion. Hoffnung lag in der Luft, als der junge palästinensische Aktivist seine Umkehr vom gewalttätigen Hamas Anhänger zum friedenswilligen Versöhner erzählte und dann der junge Siedler sein Vorbild Rabbi … zitierte: „Dieses Land gehört nicht den Juden, sondern die Juden gehören in dieses Land“. Auch er reicht seinen Nachbarn die Hand, eine herzbewegende Initiative (http://www.friendsofroots.net/)
Gleich im Anschluss führte uns die deutschsprachige Gästebetreuerin Sabina Gass über den Campus Mount Scopus der Hebräischen Universität Jerusalem (HUJ). Sie erläuterte Historie und Wissenschaft, nebenbei erhielt die Gruppe Eindrücke von der lebendigen Atmosphäre mit Studenten aus aller Herren Länder, darunter viele Kopftuchträgerinnen.
Nachmittags zeigte uns unsere Reiseleiterin Naomi Ehrlich – Kupperman, die uns die ganze Zeit begleitete, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt, das jüdische Viertel, die Tempelmauer, etc.. Wehe dem, der keine festen Schuhe anhatte.
Erschöpft aber inspiriert trafen wir am Abend noch mal in unserem Hotel Eldan den Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, Dr. Michael Borchard im Hotel zur Diskussion über Hintergründe aktueller politischer Entwicklungen in Israel aus seiner Sicht. Nicht alle seine Statements deckten sich mit den Ansichten der Reiseteilnehmer, aber gerade Kontroversen schärfen den eigenen Blick und so war dieser Abend für die anfangs müde Schar ein großer Gewinn.
Auftakt an Tag drei war der Besuch in Yad Vashem. Immer wieder interessant, berührend, traurig, auch für die, die schon da waren. Anschließend besuchten wir einen anderen Campus der Hebrew U, wie die Hebräische Universität in Fachkreisen genannt wird: Givat Ram. Hier ist das Einstein Archiv zuhause. Albert Einstein hat sein gesamtes Werk dieser Universität vermacht, nicht zuletzt weil er einer ihrer Gründerväter war. Sogar als Präsident war er im Gespräch, hat dann aber abgelehnt. Prof. Hanoch Gutfreund, selbst ehemaliger Präsident der HUJ, ist nun Direktor des Archivs. Persönlich führte er uns mit einem Diavortrag an Originaltexte des Erfinders der Relativitätstheorie heran. Sie gaben Aufschluss über Einsteins vielfältige Schriften, die sich auch mit Politik und Philosophie beschäftigten. Auch die Architektur der verschiedenen Gebäude des Campus war beeindruckend.
Nach dem Mittagessen in einer der Caféterias war es nur ein kurzer Weg zur Knesset – dem israelischen Parlamentsgebäude. Die Führung mit Erklärung der Gemälde, Fenstermalerei und ein Blick in den Parlamentssaal verschafften einen runden Einblick. Vor der Tafel mit den Bildern der insgesamt 120 Knessetabgeordneten erläuterte unsere Führerin, dass die Anwesenden farbig zu sehen sind, die Abwesenden schwarz-weiß. Tatsächlich war kein einziger Abgeordneter vor Ort, so dass unser geplantes Gespräch ins Wasser fiel.
Dafür ging es an Tag 4 richtig politisch los. Ulrich Sahm fuhr mit uns am UNO- Hauptquartier (Armon HaNatziv) und der Haas-Promenade vorbei zum Grab von Rachel. Dieser besonders jüdischen Frauen heilige Ort muss gegen die ständigen Angriffe von Palästinensern geschützt werden. Der Weg dorthin ist von Betonwänden geschützt, ein bedrückender Anblick auch die Rauchflecke an diesen Wänden von geworfenen Brandbomben. Weiter ging es zum Grenzübergang nach Bethlehem und durch das palästinensische Flüchtlingslager Daheishe. Rund um die Uno-Schule, die von Geldern der UN bezahlt wird, sind die Wände von Plakaten oder Wandmalereien bedeckt, die zum bewaffneten Kampf gegen Israel aufrufen. Als wir kurz aus dem Bus ausstiegen, waren wir im Nu von etwa 10 -12 jährigen, freundlich interessierten Mädchen umringt, die gerade aus der Schule kamen. Und dann kamen auch immer mehr etwas ältere Jungen dazu. Sie waren überaus aggressiv, tanzten uns an und fingen schließlich an, Steine aufzuheben. Das war unser Signal zum raschen Abzug. Der Stein, der mich im Rücken traf, tat weh. Aber die Frage, wie Kinder so hasserfüllt Menschen begegnen können, die sie gar nicht kennen, war wesentlich schmerzhafter. Bis wir dieses Gebiet verließen, kam ich nicht darüber hinweg. Auch der Besuch der Geburtskirche und die angenehme Mittagspause in Bethlehem halfen nicht viel. Gab es doch auf dem Platz vor der Kirche einen schwarzen Zug als Installation, der Städte Israels als Land der Palästinenser reklamierte. Viele Besucher fotografierten sich hier fröhlich. Und im deutschsprachigen Infozentrum erhält man eine Hochglanzbroschüre, die Palästinas Sehenswürdigkeiten anpreist. Auf der Karte im Innenteil ist Ostjerusalem als Hauptstadt vermerkt. In Israel, durch eine Linie abgetrennt und nicht als Israel benannt, stehen Städtenamen wie ‚Akka’, ‚Jaffa’ oder Ashdod. Diese israelischen Städte werden als arabisch beansprucht. Tel Aviv, in dessen Mitte Jaffa eigentlich nur ein Stadtteil ist, fehlt.

Aber das Essen in der Hühnerbraterei – eine Empfehlung des auch für seine Kochkünste bekannten Journalisten Ulrich Sahm – ist lecker, die Bedienung sehr freundlich. Wieder in die fröhliche Atmosphäre eines mit allen Schattenseiten gelungenen Ausflugs eingefangen ging unsere Reise nun weiter ans Tote Meer. Brütende Hitze empfing uns in Qumran, der Fundstelle der berühmten Schriftrollen. Sie umfassen rund 15.000 Fragmente von etwa 850 Rollen aus dem antiken Judentum, die von mindestens 500 verschiedenen Schreibern zwischen 250 v.Chr. und 40 n.Chr. beschriftet wurden. Die meisten sind in hebräisch, andere in aramäisch und griechisch verfasst.
Das Besucherzentrum Qumran stellt mit Ausgrabungen und Installationen die Rolle der sogenannten „Gemeinderegel“, früher „Sektenregel“, in den Mittelpunkt. Diese Gemeinderegel wird als Grunddokument einer vermuteten Qumran-Gemeinschaft betrachtet. In ihr wird ein starker Dualismus zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis angenommen. Beide Seiten werden repräsentiert durch Gott und Belial, und jeweils deren geistlicher Anhängerschaft (Engel und Dämonen) wie deren menschliche „Kinder“. Als Mensch kann man nur Kind des Lichts oder der Finsternis sein. Manche Forscher sehen in diesen Motiven einen Einfluss persischer Religion und Mythologie. Ähnlich wie im Cairo Damaskus Dokument sind strenge Regeln für die Gemeinschaft niedergelegt. Diese Lebensregeln sind zum Teil rituell, was den Tages- und Jahresablauf angeht, sehr wichtig ist aber auch die Moral, die die Anhänger auszeichnen muss. Wer den Idealen nicht genügt, wird ausgeschlossen. Auch hier taucht wieder das hierokratische Element auf, der Mensch (König/ Priester) als Abbild und Stellvertreter Gottes. Andere Rollen behandeln Texte des Tanach, aber auch Texte aus dem Alltag.
Erfreulicherweise reichte dann die Zeit noch für ein kurzes Bad im Toten Meer, bevor wir in unserem Quartier in der Wüste, dem Kibbutz Mashabe Sade, gerade rechtzeitig zum Abendessen eintrafen.
Tag fünf war nun der Erkundung der Wüste gewidmet.
Mit einem abenteuerlich aussehenden Gefährt – riesige Reifen, Sitzreihen hintereinander für jeweils etwa vier bis fünf Personen – ging es auf eine Berg- und Talfahrt mitten hinein in die Wüste. Ziel war ein Weg, der uns zu einer Quelle führte. Der Anblick einiger interessanter Vögel und Amphibien ließ die Landschaft atemberaubend erscheinen. Nun zu Fuß bis zur Wasserstelle. Die romantische Bucht war der Höhepunkt. Einige Waagemutige zogen sich die Badesachen an und sprangen hinein. Was für eine Erfrischung nach der Hitze der Wanderung. Andere kamen mit jungen Leuten ins Gespräch, die sich hier versammelten und am mitgebrachten Bunsenbrenner Tee kochten. Nach der Rückkehr fuhren wir in dem rumpelnden Gefährt quer durch karge Büsche, flache Felsen, vorbei an ausgetrockneten Flussläufen, die sich zur Regenzeit rasend schnell füllen. Dann blühen kurz die jetzt so vertrockneten Pflanzen, die dort entlang stehen. Das Fahrzeug quälte sich mit uns den Hügel bis nach Sde Boker hinauf, wo das Grab von Ben Gurion und seiner Frau aus lichter Höhe in diese Wüstenlandschaft schaut.
Busfahrer Shabi hatte hier für uns eine Mittagsjause vorbereitet: Humus, Tchina, Salat, Brot und Würstchen – alles lecker. Weiter ging’s zum Nitzana Educational Community; ein junger Freiwilliger informierte über Zionismus, Pluralismus, eigenverantwortliches Handeln, Liebe zu Israel und zur Wüste Negev – und über Mülltrennung. Für Deutsche eine Selbstverständlichkeit, in Israel noch eine Notwendigkeit, die es anzuerkennen gilt.
Vom Gebäude dieses Kibbutzes konnte man die ägyptische Grenze sehen. Diese Nähe war Inspiration des weltbekannten israelischen Künstlers Dani Karavan, auf den uns unser Mitreisender Stefan Krikowski aufmerksam gemacht hatte. Seine Installation „Way of Peace“ zwischen Israel und Ägypten, erbaut 1996–2000, ist drei Kilometer lang und besteht aus 100 runden Säulen, auf denen jeweils in einer anderen Sprache das Wort „Friede“ eingraviert ist. Die Sprachen repräsentieren alle Völker, die durch diese Gegend kamen oder hier lebten im Laufe der Geschichte. Die Sprachen Hebräisch und Arabisch beginnen und beenden den Weg.
Das anschließende Treffen mit Beduinen fand in einem „Schaudorf“ statt, nicht das, was wir erwartet hatten. Als wären es ein Kostüm trug unser Gesprächspartner beduinische Tracht, wir wurden in einem komfortablen Zelt untergebracht und mit Tee und kleinen Leckereien verwöhnt. Er erklärte beduinisches Brauchtum und Leben, war aber selbst bereits in der israelischen Gesellschaft voll integriert. Ein bisschen mehr Authentizität hätte sicher nicht geschadet.
Im Kibbutz verbrachten wir einen schönen Abend, nach dem Essen mit Wein und Unterhaltung in der lauen Abendluft. Und Brigitte aus Bonn feierte mit uns ihren Geburtstag. Idylle mit Mondschein und guten Gesprächen, was will man mehr?
Tag sechs begann mit einer langen Fahrt vom Negev in den Galil. Als erstes besuchten wir das Drusendorf Usafia-Daliat El Karmel. Wir wurden nicht nur herumgeführt, sondern auch zum Mittagessen im Haus einer Familie verköstigt. Ein interessanter Einblick ins private, unser Guide beantwortete hier auch jede Frage geduldig und freundlich. Dieses Dorf ist absolut loyal zu Israel. Drusen generell tun das in allen Gesellschaften, in denen sie leben. Trotzdem bleiben sie strikt unter sich: Wenn eine Drusin oder ein Druse eine/n Außenstehende/n heiraten will, muss er die Gemeinschaft verlassen. Man kann sich dieser Religion nicht anschließen.
Nächste Station war das Kinderdorf AHAVA, das mit dem ehemaligen Kinderheim in der Berliner Auguststraße im Ursprung in Verbindung steht. Beeindruckende Hinwendung im Konzept des Hauses, das nach dem Vorbild der Kinderdörfer Kinder aus schwierigen Familien oder Waisen in Gruppen mit einem Ehepaar aufwachsen lässt.
Ebenso beeindruckend unsere nächste Station: Das Galilee Medical Center in Nahariya. Dr. Zwika Sheleg, stellvertretender Leiter, klärte uns über die Hilfsmaßnahmen für syrische Schwerstverwundete auf, die hier kostenlos und anonym durchgeführt werden. Immerhin 3000 Menschen wurden allein in dieser Einrichtung betreut, ein enormer Kosten- und Kapazitätsfaktor. Es ist zu hoffen, dass diese humanitäre Geste sich langfristig als vertrauensbildende Maßnahme erweist, bisher ist in der Öffentlichkeit davon wenig zu hören.
Letzte Station des Tages ist der Kibbutz Degania, unser Quartier für die nächsten Tage.
Tag sieben beginnt mit einem Ausflug in den Dan National Park und zu einem Aussichtspunkt, der die geopolitische Lage der Region sichtbar macht: Links der Libanon, rechts Syrien und sogar hin und wieder Kriegsgeräusche – so nah sind Israels erklärte Feinde. Auch beim Mittagessen im Drusendorf im Golan zeigt sich, dass hier die Loyalität der Drusen noch dem ehemaligen Herrn, dem Syrischen Herrscher Assad, gehört. Vielleicht wegen der noch auf der anderen Seite der Grenze lebenden Familienangehörigen, vielleicht, weil es in der arabischen Welt eben Mainstream ist, gegen Israel zu sein.
In Emek Habacha, dem Tal der Tränen, im dort gezeigten Film zum Jom Kippur Krieg und der für Israel verlustreichen Eroberung der Golan Höhen wird deutlich, wie strategisch wichtig dieses Gebiet ist und wie wenig Israel darauf verzichten kann.
Am Nachmittag kann der Pool des Kibbutzes genutzt werden. Jede Bildungsreise braucht Pausen. Auch wenn einige jammern, es gibt sie.
In Givat Haviva, dem arabisch-israelischen Friedens- und Begegnungszentrum, informiert uns an Tag acht der arabische Israeli Samer über den Konflikt, in dem die arabische Minderheit im Land sich sieht. Mit seiner Klage über die strikte Trennung der Schulen jüdischer und arabischer Kinder berührt er einen existentiell wichtigen Punkt, der Integration verhindert. Mit seiner Klage über die Diskriminierung arabischer Dörfer durch israelische Behörden oder über ungleich schärfere Kontrollen an Checkpoints kann ihm die Gruppe nicht mehr ganz folgen. Respektieren muss man unbedingt, dass er sich nicht als Palästinenser sieht. Wer das nicht tut, verweigert ihm Anerkennung dafür, dass er so auf beiden Seiten als Außenseiter gesehen wird: Von den Palästinensern als Israeli, von den Israelis als Palästinenser.

Nach diesem eher emotional anstrengenden Treffen folgt die Fahrt nach Tel Aviv / Ramat Gan zu den Vertretern der Organisation: „Europäische Einwanderer“ (irgun jeckes). Im Elternheim „Pinchas Rosen“ verteilen wir uns auf verschiedene Tische, an denen deutschsprachige Juden sitzen, deren Wurzeln in Deutschland sind. Einigen, die in der kurzen Begegnung wenig gemeinsamen Gesprächsstoff fanden, standen wundervolle Treffen gegenüber. Fortsetzung der Beziehung aus der Heimat ist geplant, mal sehen, ob es klappt.
Der letzte Tag vor der Abreise war noch einmal politisch strukturiert. In der Deutschen Botschaft empfing uns die Vertreterin des Botschafters, da er kurzfristig nach Jerusalem reisen musste. Sie stellte sich tapfer unseren Fragen, die mich als DIG Vorstandsmitglied wirklich stolz machten: Sie waren fundiert und auch kritisch zu den oft einseitig gegen Israel gerichteten, aber immer im diplomatischen Rahmen agierenden, politischen Aktionen der Außenstelle der Bundesregierung.
Die Besichtigung der „Weißen Stadt“ mit unserer Tourguidin Naomi Kupperman-Ehrlich folgte und am Ende war auch ein kurzes Shopping auf dem Markt und im noch nicht so chicen Ausgeh-Viertel möglich.
Viel Zeit blieb nicht, denn das Treffen mit der Israelisch-Deutschen-Gesellschaft IDG, der Schwesternorganisation in Israel, folgte anschließend. Der Vorsitzende, Grisha Alroi-Arloser, ist auch gleichzeitig Vorsitzender der Israelisch-Deutschen Handelskammer. So konnte er einen kurzen Einblick in die Dt.-Isr. Wirtschaftsbeziehungen geben, flankiert von Kollegen aus der IDG, die ihrerseits Vertreter aus der Wirtschaft sind.
Nach dem Abendessen in unserem Hotel Gilgal gelang unserem Reisekollegen Andrew Walde noch ein Coup: Er präsentierte den bekannten Zeitzeugen Noah Klieger, der uns einen Auszug aus seiner unglaublichen Lebensgeschichte erzählte. Anschließend hatten wir noch gemütlichen Ausklang in der Hotellobby mit kurzem Feedback zur Reise, dass nach anfänglichem Zieren doch sehr gehaltvoll wurde.
Fazit: Keiner klang enttäuscht oder negativ, alle waren zufrieden und bereichert. Was will man mehr?
Reisebericht der Israelreise vom 15.5. bis 24.5.2016
Von Monika Thamm
Vorstandsmitglied der DIG Berlin und Potsdam
Mein Reisebericht über die Reise von Mitgliedern der Deutsch-Israelischen Gesellschaft nach Israel vom.
Einleitung:
Es liegt bei dieser Überschrift eine Betonung auf „mein“ – will heißen: Der Bericht enthält nicht nur die Fakten und Aufzählungen der Reiseroute, sondern auch eine Darstellung meiner persönlichen Eindrücke und Einschätzungen. Der Text ist – was die Chronologie angeht – ein Reisebericht klassischer Darstellung. Ich habe aber Subjektives von Objektivem säuberlich getrennt dargestellt und nicht vermischt. Besuchen, die mich sehr beeindruckten, habe ich mehr Raum in der Darstellung gegeben als anderen, und es sind Programmpunkte auf wenige Zeilen zusammengeschnurrt, obwohl sie weit mehr Zeit in Anspruch nahmen.
(frei zitiert nach: Caput Nili – Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils, von Richardt Kandt, Berlin 1905).
Über meine Mitreisenden will ich gleich vorweg sagen: Es war eine sehr angenehme Reisegesellschaft; sie war vom Alter her verhältnismäßig homogen, der Kenntnisstand über Israel, Land und Leute war sehr gut, und da auch die zwischenmenschliche Komponente stimmte, gab es über das offizielle Beisammensein im Rahmen des Programms hinaus viele angeregte Gespräche, Diskussionen und gemeinsame Aktivitäten.
Unsere ständige Reiseführerin Naomi war einigen Reiseteilnehmern bereits bekannt als sehr nette und sachkundige Begleiterin – das konnten auch jene erfahren, die Naomi noch nicht kannten: Sie zeigte mit uns Geduld, überforderte nicht unser Aufnahmevermögen und wenn es Terminschwierigkeiten gab – Naomi wußte Rat. Ich glaube, wir hatten großes Glück mit ihr.
Erster Tag – Sonntag, 15.5., Abflug von Schönefeld-Ankunft Tel Aviv-Fahrt nach Jerusalem
Verspäteter Abflug –verspätete Ankunft. Ruhiger Flug, aber wacklige Landung auf dem Flughafen Ben Gurion, Tel Aviv. Grund war der Chamsin – ein heißer Wüstenwind aus Jordanien.
Bustransfer nach Jerusalem; auch hier war es ungewöhnlich heiß: tagsüber mehr als 30 Grad – üblicher Durchschnitt zu dieser Jahreszeit 23 – 25 Grad.
Ins Hotel, Koffer abstellen, ab zum Abendbrot und gleich danach zu einem Vortrag von Arye Sharuz-Shalicar, dem sicherheitspolitischen Sprecher der israelischen Armee für Europa.
Herr Sharuz-Shalicar hat eine interessante Vita: Vom Mitglied einer türkischen Jugendgang in Berlin-Wedding zum arrivierten Mitglied der Armee. Als Sohn nach Deutschland ausgewanderter iranischer Juden war er Ende der 90er Jahre Mitglied einer Bande junger Türken. Seine jüdische Herkunft spielte für ihn keine Rolle – er war persischer Herkunft – das war’s. Seine türkisch-muslimischen Freunde wußten es auch nicht. Er klaute, prügelte sich mit verfeindeten Gangmitgliedern, zerstörte und beschädigte fremder Leute Eigentum, war Sprayer und stand mehr als einmal kurz vor einem Knastaufenthalt. Erst als seine jüdischen Wurzeln in seiner Gang ruchbar wurden, fing das Spießrutenlaufen an: gemobbt, verprügelt, gedemütigt – das waren von da an seine täglichen Erfahrungen. Und in dem Bewußtsein, ein Jude zu sein, zog er schlußendlich die für ihn logische Konsequenz: Er wanderte aus nach Israel, leistete seinen Wehrdienst in der Armee und fand bei ihr seine Aufgabe. Wer über sein Leben, seine Erfahrungen mehr wissen will, der lese sein Buch „Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude“. In seinem Vortrag schilderte er das kompliziert konstruierte und wackelige Fundament, auf dem der israelische Staat steht. Er zog einen Bogen um die Grenzen Israels:
Ruhe und kooperative Zusammenarbeit kennzeichnen das Verhältnis zu Jordanien. Die dortige Regierung hat es auch nicht leicht: über zwei Mio Flüchtlinge aus den nachbarlichen Kriegsgebieten, die Mehrheit der Bevölkerung sind Palästinenser.
Die syrische Grenze wird von Israel scharf beobachtet und kontrolliert: Im Grenzgebiet Syriens begann der Aufstand gegen den Machthaber Assad, und der IS ist in dieser Gegend fest verankert. Die Grenze des libanesischen Nachbarn zu Israel wird von der Hisbollah kontrolliert. Die Hisbollah erhält Geld und logistische, moralische Rückendeckung aus dem Iran. Seit ihrer Gründung im libanesischen Bürgerkrieg (1975-190) hat sie sich die Vernichtung Israels zum Ziel gesetzt.
Die Hisbollah-Mitglieder sind keine irrational handelnden Spontis, sie sind strategisch denkende, klug aufgestellte und dem entsprechend handelnde Kampftruppe. Schließlich – die Grenze zum Gazastreifen. Dort herrscht eine unheilvolle, schwer zu kalkulierende Gemengelage – die Hamas, zwar siegreich aus einer Wahl hervorgegangen, ist längst nicht mehr alleiniger Herr im Hause. Ihre Erfolglosigkeit in ihrem Kampf gegen Israel kränkt die Hamas. Es herrscht dort eine korrupte Führungsschicht, und es lebt – oft genug im Elend – eine palästinensische Bevölkerung, die letztlich niemand von den arabischen Bruderstaaten haben will – auch nicht die palästinensische Regierung von Mahmoud Abbas in der Westbank. Das alles bildet eine gefährliche, explosive Mischung.
Die Grenze zum Gazastreifen ist nach meiner Meinung in einem dauerhaft schwebenden Zustand zwischen gegenseitigen Unnachgiebigkeiten, Mißtrauen, aufflackernden Gewaltausbrüchen. In diese sich aufgetane Lücke durch Unfähigkeit, Korruption, Hoffnungslosigkeit haben sich radikale Gruppen eingenistet, so Ableger des IS.
Der politische Führer der Palästinenser, Mahmoud Abbas mag eine weltweit anerkannte Autorität sein – aber er ist 84 Jahre alt – wer und was kommt nach ihm?
Herr Sharuz-Shalicar sieht Israel auch auf einem schmalen Grat schreiten zwischen demokratischen bürgerlichen Freiheiten, dem Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit, dem Preis für diese Sicherheit für Land und Leute und der Sehnsucht nach Frieden. Das Thema Siedlungspolitik blieb in diesem Gespräch ausgespart – es ist für den Armeesprecher ein Thema, das einer politischen Lösung bedarf und nicht einer militärischen. Und nach meiner Meinung verdeutlicht diesen Zustand nichts besser als die Grenze oder auch Nicht-Grenze zur Westbank: Aufgeteilt in verschiedene Zonen wie ein Flickenteppich mit unterschiedlicher autonomer Bestimmung, einer latent feindlich gesinnten Bevölkerung ist dieses Gebiet für einen Beginn friedlicher Koexistenz von höchster Priorität.
Montag, 16.5.16 – Jerusalem
Besuch in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft im Gebiet der Westbank: Sie nennt sich Friends of Roots. Der Name ist offensichtlich Programm: Aus dem Gedanken ihrer gemeinsamen historischen Wurzeln wurde die Bewegung, gegründet von Israelis und Palästinensern, deren Ziel es ist, das gegenseitige Verständnis für die Lebensumstände beider Völker zu wecken und – daraus folgend – ein friedliches Miteinander zu fördern. Ein palästinensischer und ein amerikanischer jüdischer Bewohner beschreiben uns ihre Herkunft und ihre Lebensläufe, welche sie letztendlich in dieser Bewegung ihre Heimat finden ließ.
Danach stand der Besuch bei Studenten der Hebräischen Universität auf dem Programm. Ich war bei diesem Programmpunkt nicht dabei. Es wurde mir aber berichtet, daß die Ansichten, welche die Studenten äußerten, deutlich machten, welche Gegensätze und Probleme eine Bewegung wie Friends of Roots noch zu überwinden hat.
Auch bei der anschließenden Führung durch die Jerusalemer Altstadt war ich nicht dabei. Mein Mann und ich besuchten Freunde; sie sind schon sehr alt und die Jahre, in denen wir uns treffen können, werden knapp.
Im Hotel trafen wir am Abend von der Konrad-Adenauer-Stiftung Dr. Borchart. Thema war die aktuelle politische Entwicklung in Israel und die Rolle sowie Möglichkeiten, die eine regierungsnahe Stiftung dabei haben kann.
Dienstag, 17.5.16, Yad Vashem-Universität-Knesset
Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem
Nicht alle Teilnehmer/innen sind in die Gedenkstätte hineingegangen: Die Gründe waren unterschiedlicher Natur: Die Einen waren schon etliche Male dort, andere wußten – auch aus Erfahrung – wie sehr sie der Besuch belasten würde. Sie sind durch den Garten gegangen, haben die Allee der Gerechten durchschritten und sich die Erinnerungsdenkmale angesehen.

Anschließend war der Besuch der HJU (Hebrew Jerusalem University). Prof. Hanoch Gutfreund erzählte uns – teilweise in deutscher Sprache – viel über die Gründungsgeschichte der Universität. Die HJU ist die zweitälteste Universität Israels – eröffnet wurde sie 1925. Das Baugrundstück an dem Skopusberg wurde von russischen Juden erworben. Während des Unabhängigkeitskrieges 1948/49 war der Skopusberg vom Rest des israelischen Jerusalem abgeschnitten und bildete somit eine Exklave. Der Lehr- und Lernbetrieb wurde verlagert zum neu gegründeten Givat Ram-Campus. Erst der Sechstagekrieg in 1967 brachte den Skopusberg wieder in israelischen Besitz.
Die älteste Studieneinrichtung ist übrigens das Technion, das Israelische Institut für Technologie in Haifa – eröffnet 1924.
Das Zentralgebäude der HJU wurde 1954 erbaut. Bedeutende Bauhaus-Architekten waren an der Gestaltung der Universitätsgebäude beteiligt: Richard Kauffmann, Ossip Klarwein, Heinz Rau.
Der Gedanke zu einer Universität entstand bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1926 existiert der Freundeskreis der hebräischen Universität. Ein Förderkreis für die Gründung einer Universität sammelte 500 Tsd Reichsmark für die Errichtung – der Spendenaufruf und die Spenderliste mit Namen und Spendenbeiträgen sind im Archiv der Universität. Die grundlegende Idee war eine Zusammenarbeit von deutschen und hebräischen Wissenschaftlern. Die Liste des Unterstützervereins enthielt illustre Namen: Albert Einstein, Stefan und Arnold Zweig, Max Liebermann. Viele bedeutende Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst waren vertreten. Der junge Martin Buber, der Soziologe und Nationalökonom Franz Oppenheimer sowie Oscar Wassermann, ein Mitglied des Generalrates der Reichsbank, gehörten zu den Förderern. Weitere Freundes- und Förderkreise wurden in ganz Europa gegründet, z. B. entstand ein bedeutender Zirkel in England. Prof. Gutfreund zeigte aus dem Archiv zahlreiche historische Dokumente aus der Entstehungsgeschichte der Universität.
Mit dem Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten und dem Ausbruch und Ende des zweiten Weltkriegs, wurde die einzigartige europaweite und transatlantische Verbindung von Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik zerstört. Die zerstörte Freundschaft zwischen deutschen und hebräischen Wissenschaftlern wurde erst 1957 mit den ersten Kontakten zur neu gegründeten Freien Universität in Berlin wiederbelebt. Jetzt ist die Zusammenarbeit zwischen europäischen Universitäten und der HJU erfolgreich und vertrauensvoll.
Die Universität beherbergt in ihrem Archiv auch einen Schatz: Den nahezu kompletten Nachlaß von Albert Einstein: über 80 Tsd. Dokumente (Briefe, Abhandlungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen- darunter auch eine Darstellung der Relativitätstheorie -, die persönliche Korrespondenz Einsteins) sind hier gelagert. Bei Veröffentlichung seines wohl bekanntesten Werks gab es viele Gegner; viele dieser Schriften waren unverhohlen antisemitisch, wie Prof. Gutfreund an einigen Dokumenten belegte. Zu diesen antisemitisch gesinnten Gegnern gehörte auch der Dekan des Physikinstituts von der Universität Heidelberg, Prof. Philipp Lenard.
Anschließend stand der Besuch der Knesset, dem israelischen Parlament auf dem Besuchsplan. Immer wieder schön anzusehen sind die farbenprächtigen Wandteppiche von Marc Chagall. Das Triptychon zeigt in allegorischer Form die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft Israels.
Es war kein Plenartag, der Abgeordnetensaal war also leer. Unter dem Bild von Theodor Herzl treffen sich die 120 Abgeordneten des Plenums; 27 von ihnen sind Frauen, 16 Abgeordnete sind Muslime und Christen. Vertreten sind z. Zt. 10 Parteien. Diese hohe Zahl erklärt sich wohl auch daraus, daß der Mindestprozentsatz für den Einzug ins Parlament für eine Partei nur 3,25 % der Wählerstimmen beträgt. Eine Legislaturperiode beträgt 4 Jahre.
Mittwoch, 18.5. 16 – Bethlehem-Qumran-Totes Meer
Check-out Eldan-Hotel
Mit dem Bus in Richtung Westbank – am Rande von Jerusalem stieg der Journalist und ausgezeichnete Israel-Kenner Ulrich Sahm zu uns. Herr Sahm ist freier Nahostkorrespondent und lebt seit 40 Jahren in Jerusalem. Sein Thema ist das Verhältnis Israels zu den Palästinensern und zum Rest der Welt. Während der Fahrt nach Bethlehem war er unser „Fremdenführer“ – unserer Reisebegleiterin Naomi war es als Israelin nicht erlaubt, in die Autonome Zone zu reisen. Herr Sahm ist – wie bereits erwähnt – ein ausgezeichneter Kenner
des gegenwärtigen Zustands im Nahen Osten. Er verstand es hervorragend, uns die historischen Zusammenhänge darzustellen. Durch seine Erläuterungen wurde vielen von uns klar, warum bis heute das friedliche Zusammenleben von Palästinensern und Juden nicht reibungslos verläuft; weshalb es zur ersten, zur zweiten Intifada kam, welche Versäumnisse, Fehleinschätzungen, politischen und menschlichen Fehler auf beiden Seiten geschahen.
Schlußendlich habe ich Herrn Sahm so verstanden, daß es nicht zuletzt durch die Zerstrittenheit der palästinensischen Führungsgruppen und deren jeweiliger Alleinvertretungsanspruch, für alle Palästinenser zu sprechen, sowie der Absolutheitsanspruch der palästinensischen Führer auf das Land von ganz Israel eine dauerhafte, krisensichere Lösung verhindert. In diesem Absolutheitsanspruch – der sich auch in zahlreichen Propagandadarstellungen in Bethlehem manifestierte – ist auch das Scheitern von Itzak Rabins Initiative „Land für Frieden“ zu verstehen. Und wenn ich Herrn Sahms Darstellungen richtig interpretiere, dann besteht z. Zt. von Seiten der palästinensischen Regierung kein Wille, den unsicheren Status quo in dieser Region zu ändern: Unsere Begegnung mit Jugendlichen – es waren alles Jungen, die offensichtlich aus einem nahe liegenden Flüchtlingslager kamen, waren symptomatisch: Wir wurden mit Steinen beworfen. Diese jungen Menschen kennen nichts anderes als ein Leben in einem Lager, sie werden nicht dazu erzogen, sich Lebensperspektiven durch eigene Arbeit zu schaffen. Sie – so wie ihre Großeltern und Eltern – leben von den Unterstützungen der UN, von den Geldern vieler Staaten auch aus Europa, von den Hilfestellungen regierungszugehöriger und regierungsfreier Institutionen. Ein eigener Staat Palästina – in welchen Grenzen auch immer – müßte für sich und seine Bevölkerung selbst sorgen; er würde auf den Status eine Entwicklungslandes zurückfallen – und finanziell wäre das ein gewaltiger Abstieg. Erschreckend in dem Zusammenhang war für uns auch der krasse Gegensatz von der – nur aus sicherer Entfernung zu erkennenden vernachlässigten Flüchtlingssiedlung zu den schön verzierten und mit Gärten gestalteten Häuser in anderen Vierteln Bethlehems. Ich persönlich glaube, daß Bethlehem – nicht zuletzt durch seine religiöse Bedeutung und damit als beliebtes Ziel christlicher Touristen eine herausragende Rolle spielt, die Stadt profitiert von ihrem historischen Ruf. Zurück auf israelischem Gebiet verabschiedete sich unser Begleiter und Naomi, unsere ständige Begleiterin, übernahm.
Die Fahrt ging weiter zu den Ausgrabungsstätten von Qumran im Westjordanland, in der Nähe des heutigen Kibbuzes Kalia. Nach den ersten Funden im Jahre 1947 in den Höhlen dieser Gegend begannen Anfang der 1950er Jahren systematische Ausgrabungen, bei denen viele Schriftrollen gefunden wurden. Daß ein Beduine beim Suchen nach einer entlaufenen Ziege die Rollen fand, gehört wohl eher in das Reich der Legenden: Die Familie des Beduinen war bekannt dafür, daß sie mit archäologischen Funden handelte. In einer sehenswerten musealen Darstellung wurde die Geschichte einer jüdischen Gemeinschaft aus dem 1. Jahrhundert nach Christus den Besuchern gezeigt. Der Besucher kann sich durch die Ausstellung von Münzen, Keramiken, Werkzeugen und Alltagsgegenständen ein Bild vom Leben dieser Gemeinschaft machen. Die Gemeinschaft hat sich aus religiösen Gründen gebildet – es sind die Qumram-Essener. Die religiösen Rituale und das Schreiben der Rollen waren den Männern vorbehalten. Aber es war keine reine Männergemeinschaft; Schmuckstücke für Frauen sind gefunden worden. Und es gibt Grabstätten, in denen Frauen und Kinder gelegen haben. Der anschließende Rundgang durch die Anlagen, in denen die Mitglieder damals lebten, gab uns eine Vorstellung vom Alltag, vom Leben und Arbeiten in dieser Gemeinschaft.

Danach ging die Fahrt zum Toten Meer – für alle, die das erste Mal in Israel sind, sowieso ein Muß. Aber auch wer schon mehrere Male im Lande war: Die Busfahrt von der Höhe der Qumram-Höhlen hinunter auf 428 m unter dem Meeresspiegel (gemessen an der Wasseroberfläche) ist ein Erlebnis. Hauptsächlich wird das Tote Meer gespeist vom Jordanzufluß. Es ist eigentlich ein abflußloser großer Salzsee. Da aber die Zuflußmenge in den vergangenen Jahrzehnten radikal für die Landwirtschaft (Obst-, Gemüseanbau für den Export) abgeleitet wurde, trocknet das Tote Meer zunehmend aus. Des Problems ist sich Israel bewußt, und es existieren Pläne, vom Süden aus dem Roten Meer oder aus dem Osten vom Mittelmeer eine Wasserzufuhr zu bauen – ein sehr aufwändiger, teurer Plan!
Wenn das sulfatreiche Rote-Meer-Wasser mit dem kalziumhaltigen Wasser des Toten Meeres sich mischt, dann entsteht Gips. Dieser Vergipsung muß durch große Mischungsbecken vorgebeugt werden. – Das ist übrigens keine Erkenntnis von mir, sondern auf unserer vorigen Reise hat das der damalige Reiseführer erklärt!
Es war etwas Zeit, um ein kurzes Bad im Toten Meer zu nehmen. Ich habe darauf verzichtet:
Die Prozedur: Umziehen, Nachspülen mit Süßwasser nach dem Bad, wieder umziehen – war
mir zu viel.
Die Fahrt ging weiter zum Kibbuz Mashabei Sade – unserer Station für zwei Übernachtungen
Donnerstag, 19.5.16, Negev
-Highlight!!
Eine Fahrt mit einem zu einem wüstentauglichen Gefährt umgebauten LKW durch die Wüste Negev. Negev heißt auf hebräisch trocken; die Negevwüste ist eine Trockenwüste. Sie bedeckt mit 12.000 qkm rund 60 % des Landes. Es ist mir einsichtig, daß der Staat viel Geld und Energie da hinein steckt, um diese Landschaft für die Bewohner nutzbar und lebenswert zu machen. Weite Teile sind der militärischen Nutzung vorbehalten. Die Stadt Dimona ist ein Beispiel dafür. Die Fahrt ging streckenweise querfeldein durch ausgetrocknete Wadis,
über Stock und Stein. Das tat nicht jedem Rücken meiner Mitreisenden gut. Mein Hinweis, daß die Fahrt vor zwei Jahren um einiges weniger komfortabel war (keine Sitzkissen und mehr querfeldein) fanden sie wenig tröstlich. Aber – ein Erlebnis war es für Alle! Der Spruch „Die Wüste lebt“ (nach einem Walt-Disney-Naturfilm von 1953) stimmt. Schon vom LKW aus sahen wir niedrige Büsche und Sträucher, die nach Regenfällen weißgelb oder rosa blühen. Es gibt Büsche, die in ihren eßbaren Blättern, Salz speichern. Ich habe die Blätter gekostet.
Die Tierwelt der Negevwüste ist mannigfaltig: Es gibt nubische Steinböcke, Halbesel und Oryxantilopen wurden wieder ausgewildert, weil sie einst dort heimisch waren. In wenigen Exemplaren gibt es arabische Leoparden, Streifenhyänen und arabische Wölfe. Im Süden kommen häufig Gazellenarten vor.
Ich habe auf dem Fußweg zu einem kleinen See mit Wasserfall aber nur kleine, wüstensandfarbene Eidechsen gesehen. Das Teichwasser soll kalt gewesen sein – so die Aussage von ein paar Mutigen, die hineinsprangen. Ich begnügte mich mit nassen Füßen.
Unser Busfahrer empfing uns am Kibbuz Sde Boker zu einem Picknick. Sde Boker gehört auch zu den unerläßlichen Besuchsstätten: Hier lebte und starb der Staatsgründer Ben-Gurion. Wir besuchten die Gräber von Paula und David Ben Gurion. Sie sind auf einer kleinen Plattform, und von dort hat man einen wunderbaren Blick in das Zinntal. Ein Rundgang durch den Garten des Kibbuz zeigt eine schöne, gepflegte Anlage mit geschnittenen Hecken, Gewürzbäumen (Roter Pfeffer) und Blumenbüschen.
Danach fuhren wir zu einem Beduinendorf.
Nach meiner Einschätzung war dieses Dorf kein Vergleich zu der Häuser- und Hüttenansammlung, die wir vor zwei Jahren im Negev besuchten. In einem großen Zelt erzählte uns damals bei Tee und Mittagessen der Sprecher oder Dorfvorsteher von seinen Plänen für das Dorf, dem Leben seiner Familie in der Wüste. Selbstverständlich gingen seine Kinder in die Schule – der Schulbus holte sie jeden Tag an der Straße ab. Aber in der schulfreien Zeit blieb der große Sohn bei den Kamelen tagelang in der Wüste. Der Vater selbst hielt die Traditionen seiner Vorfahren aufrecht und zog ebenfalls für ein paar Wochen mit den Tieren durch die Negev.
Auf der anderen Seite bemühte er sich um Fortschritt bei sich und seinen Nachbarn: Mit einfachsten Mitteln entwickelte er eine Biogasanlage, die – wenn es gut geht – der Versorgung der Mitbewohner dienen soll.
Natürlich war auch das wohl nur ein Abglanz alter Bedu-Traditionen – die moderne Zeit geht über die Nomadenlebensweise hinweg und wird diese gründlich ändern.
Was aus dem Projekt wurde, weiß ich nicht; auf dieser Reise war ein Besuch bei ihm nicht möglich.
Diese Veränderungen waren bei dem diesjährigen Besuch auf dieser Reise erkennbar. Die Beduinen, die wir dieses Mal besuchten, wohnen in festgefügten Häusern, das Besucherzentrum war im Blockhüttenstil errichtet. Ich sah auch kleinere Zelte – ob diese als ständige Behausung dienten, glaube ich nicht. Wir wurden als Gäste auch in einem großen Zelt empfangen, und der Gästebetreuer erzählte anekdotenhaft von seiner Familie. In einem Pferch konnten wir Kamele betrachten.
Unser nächstes Ziel war die Nitzana Educational Community. Hier leben junge Israelis, junge ausländische Besucher oder Einwanderer, die für ein paar Wochen in Wohngemeinschaften in dem Dorf leben, lernen und arbeiten. Kernthemen der Seminare sind: die Bedeutung der Wüste für das Land, ökologische Programme, z. B. Recycling von Wertstoffen, Wasserwirtschaft, (Solar)-Energiewirtschaft u.ä. m. Für die jungen Einwanderer gibt es Seminare, welche sie auf das Leben in Israel vorbereiten. Dazu gehören auch Themen, wie: der Dienst in der Armee, die Arbeitsplatzsuche, die Möglichkeiten für ein Studium, das Vertrautmachen mit dem täglichen Leben in Israel. Ferner werden junge Menschen aufgenommen, die Probleme haben. Für sie ist Ziel ihres Aufenthalts: der Lernprozeß zur Bewältigung ihrer Probleme.
Auch wenn der junge Betreuer es nicht so deutlich sagte; ich vermute, es geht u.a. auch um Drogen- oder Alkoholabhängige oder um junge Menschen, die durch ihre Suchtprobleme auf die schiefe Bahn geraten sind. Mir erscheint das als eine Art Synanon auf israelisch.
Da eine Fahrt an die ägyptische Grenze aus Sicherheitsgründen nicht möglich war, machten wir eine Fahrt zu dem Denkmal „The Way of Peace“ von dem berühmten israelischen Bildhauer Dani Karavan. Das sind weiße Säulen, die die Grenzverläufe zwischen Ägypten und Israel verknüpfen. Unsere Aufmerksamkeit für die Erklärungen wurde aber beeinträchtigt von der Entdeckung eines Käuzchenpaares auf einem Baum. Die Fotoapparate klickten.
Gegen Abend erreichten wir wieder den Kibbuz Mashabei Sade.
Freitag, 20.5., Von der Negevwüste in den Norden zum See Genezareth
Die Fahrt ging zu einem Drusendorf. Ein drusischer Reiseführer zeigte uns sein Dorf – und erklärte die Herkunft, Lebensweise und die religiös-gesellschaftlichen Zusammenhänge der Drusen. Ursprünglich sind die Drusen wohl eine aus Ägypten ausgewanderte Gruppe, die sich im frühen 11. Jahrhundert als Religionsgemeinschaft etablierte. Der Hang zur abgeschlossenen, abgeschotteten Lebensweise führt die Drusen in diese entlegenen Gebirgsgegenden. Sie leben heute im Grenzgebiet von Syrien, Libanon, in Israel und zu einem sehr geringen Teil in Jordanien. Und darin liegt wohl auch die Tragik dieses Volkes. In dieser Zeit ständiger militärischer Auseinandersetzungen von gegeneinander feindlich gesinnten Nachbarn sind die Drusen als Volk in vier Staaten zu Hause. In Israel leben sie in 18 Dörfern zwischen Akkon im Westen und Safed im Osten sowie in 4 Dörfern auf den von Israel annektiertem Golanhöhen. Die Drusen in diesem Dorf Dahat El Karmel lebten von Anbeginn im Staatsgebiet Israels – sie fühlen, denken und leben als Drusen – sind aber treue Staatsbürger Israels. Söhne und Töchter können und tun es auch – zur Armee gehen. Sie haben ein eigenes Bataillon und im Ernstfall werden sie nicht an einer Front im Norden eingesetzt – eine Beteiligung an kriegerischen Auseinandersetzungen mit ihren drusischen Glaubensbrüdern jenseits in Syrien oder Libanon soll vermieden werden.
Die Atmosphäre in dem Ort empfand ich als entspannt; die Menschen fühlten sich offensichtlich wohl in ihrer Umgebung. Ich erwähne das, weil wir am folgenden Tag ein weiteres Drusendorf am Fuße des Bergs Hermon besuchten, in dem ich eine ganz andere Stimmung gefühlt habe. Ich werde im Folgenden darauf noch zu sprechen kommen.

Jetzt zurück zu diesem Reisetag. Die nächste Station war das Kinderdorf „Ahava“ – auf deutsch „Liebe“ in Kiryat Bialik. Und dieser Name ist wohl auch Programm. Das Kinderdorf wird unterstützt von der Bnai Zion Stiftung. Hier leben – vergleichbar mit unseren Kinderdörfern – Waisen aber auch Kinder und Jugendliche aus problematischen Familienverhältnissen – in einer „Familie“ mit Pflegeeltern. Es leben hier 200 Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren, 170 von ihnen leben jeweils in einer Gruppe von bis zu 12 Kindern zusammen wie in einer Familie. 30 Kinder kommen tagsüber hierher. Gefördert wird die Einrichtung auch aus privaten Spenden, zum großen Teil von amerikanischen Juden, wesentlicher Geldgeber ist jedoch der Staat.
Da viele Kinder aus problematischen Umfeldern kommen, gibt es sozialtherapeutische Betreuung.
Sie gehen hier zur Schule (1.- 9. Klasse). Psychologen, Psychiater, Sozialarbeiter unterstützen die Pflegeeltern in der Erziehung und Betreuung der Kinder. Die jungen Menschen kommen auf Vermittlung durch die Sozialämter, sie sind jüdischer oder arabischer Herkunft, auffallend häufig auch aus Ehen, wo die Elternteile arabischer und jüdischer Herkunft sind. Daneben gibt es noch eine Notfallunterkunft für den Fall, daß eine schnelle Unterbringung erforderlich ist. Über „Erfolgsquoten“ wird kein Buch geführt: Wenn die jungen Menschen die Einrichtung mit 18 Jahren verlassen, dann bleibt die Hoffnung, daß sie ihren Platz in der Gesellschaft finden werden. Manche müssen in andere betreute Einrichtungen gehen. Es gibt auch junge Menschen, die für immer in Ahava bleiben.
Hervorgegangen ist das Kinderdorf aus der Einrichtung Ahava in Berlin in der Auguststraße, nahe der großen Synagoge in der Oranienstraße. Das war eine Sammelstelle für Kinder verfolgter Juden aus Deutschland und Polen. Sie wurden dorthin gebracht, auf die Ausreise nach Palästina vorbereitet und dann in Sicherheit gebracht. Über 300 Kinder wurden von dort gerettet, deren Eltern es gelang, ihre Kinder dort unterzubringen, in der Hoffnung auf einen sicheren Kindertransport nach Palästina. Das gelang von 1935 an auch bis 1944, danach waren Transporte nicht mehr möglich; die letzten Kinder wurden zum großen Teil in Auschwitz umgebracht. Das Mutterhaus in der Auguststraße, auf der Rückseite des Zentrums Judaicum steht noch; es wurde später ein Waisenhaus – aber seit vielen Jahren steht es leer und verfällt zusehends, da die Stiftung nicht genug Geld für eine Sanierung hat.
Zurück zur Gegenwart – in dem Dorf gibt es neben der Schule auch kleine Werkstätten für kreative Beschäftigung – Basteln, Malen, Holz- und Tonarbeiten konnten wir sehen. In Basaren werden auch Stücke verkauft. Es gibt einen Streichelzoo, denn der Umgang und die Pflege von Tieren fördert die seelische und geistige Entwicklung der Kinder. Diesem Ziel dient auch der Garten mit dazugehörigem Gewächshaus. Dieser Besuch war für mich einer der Höhepunkte der Reise.
Der nächste Höhepunkt war für mich der Besuch eines Krankenhauses in Nahariya. Gegründet wurde das Krankenhaus vom JNF-KKL, dem Jüdischen Nationalfonds Keren Kayemeth LeIsrael. Er half maßgeblich beim Aufbau und der Entwicklung des Landes. Dazu gehörte auch die Gründung eines kleinen Krankenhauses in Nahariya im Jahre 1954 – dem Engel Health Center. Wir wurden empfangen von einem Delegierten der JNF-KKL.
Die Verbindungen der Organisation mit dem Krankenhaus stammen noch aus jenen 50er Jahren und sind nicht abgerissen. Jetzt ist das Hospital ein sehr wichtiges Zentrum im Norden Israels.
Der Delegierte zeigte in einem Präsentationsfilm, was das Krankenhaus leistet – jedes Jahr kommen hier über 5.000 Babies zur Welt – und welche Schwerpunkte es setzt. Das Galilee Medical Care Center – das ist jetzt der offizielle Name – ist eine Besonderheit. Die Einrichtung ist mehr als ein Krankenhaus: Im Rahmen seiner Sanierung wird es zum Forschungszentrum mit dem Schwerpunkt Neurochirurgie erweitert. Ein Grund dafür ist auch, daß hier Patienten aus Syrien behandelt werden – die Grenze ist nur 10 km entfernt. Hierher wird nicht nur die kranke syrische Landbevölkerung aus dem Grenzgebiet gebracht, sondern auch Soldaten: Syrer – viele mit kriegsbedingten Kopfverletzungen – werden nachts über die Grenze nach Israel gebracht und in dem Krankenhaus anonym medizinisch behandelt. Sie werden operiert, erforderlichenfalls auch durch Rehabilitationsmaßnahmen stabilisiert und dann – wieder nachts – an die syrische Grenze zurückgebracht.
Ich glaube, daß die verantwortlichen Stellen – sei es Verwaltung oder Armee auf beiden Seiten wissen, was das Krankenhaus in Nahariya leistet. Aber es wird offiziell darüber nicht geredet – weder von syrischer noch von israelischer Seite. Eine offizielle Behörde ist in diese Arbeit auch nicht eingeschaltet.
Der Arzt, Dr. Zvika Sheleg, – er ist spezialisiert auf Augenverletzungen – der uns diese Arbeit schildert, sagt, daß in den letzten 3 Jahren über 1.000 Patienten aus dem syrischen Grenzgebiet behandelt wurden. Es gibt Patienten, die bleiben 4-6 Wochen, andere bleiben Monate. Die Behandlung erstreckt sich lediglich auf die körperliche Genesung, eine (psycho)-therapeutische Behandlung kann nicht geleistet werden. Näheres erfahren wir nicht- das dient der Sicherheit des Krankenhauses, des behandelnden und pflegenden Personals und in erster Linie der Sicherheit der Patienten, die auch anonym bleiben. Auf eine Frage aus unserer Gruppe, ob denn auch IS-Terroristen behandelt würden, sagte der Arzt, sie würden nicht fragen, woher der Patient käme und wohin er hinterher ginge. Ein Drittel der syrischen Patienten sind Frauen und Kinder, zwei Drittel sind Soldaten und Bauern. Zur Zeit sind 40 syrische Patienten im Haus. Die Kosten trägt der israelische Staat.
Ein Behandlungsschwerpunkt ist – wie bereits erwähnt – die Neurochirurgie. Die Erfahrungen, die das Krankenhaus aus der Behandlung solcher Verletzungen, insbesondere der Traumatabehandlungen von Schwerverletzten sammelt, werden katalogisiert; sie sind weltweit eine wertvolle Hilfe für Krankenhäuser in anderen Krisengebieten. Auf diese Art von Schädelverletzungen hat sich das Krankenhaus spezialisiert und die neurochirurgische Abteilung ist führend im Lande. Das Krankenhaus hat 600 Betten, der Einzugsbereich umfaßt 600.000 Menschen. Auf 1.000 Patienten kommen 4,6 Ärzte – dass ist nach Aussage des Arztes ungefähr die halbe Relation Patienten/Ärztequote im Vergleich zum Süden Israels. Die Arbeitsbelastung in dem Nahariya-Krankenhaus ist also enorm.
Nach dem Vortrag führt uns der Arzt durch einige Abteilungen des Krankenhauses. Es gibt auch unterirdische, raketensichere Behandlungsräume, damit die Patienten, die gerade operiert werden, in einer Beschußsituation nicht verlegt werden müssen. Auch die ebenerdigen Behandlungsräume sind so gebaut, daß sie unter Beschuß betriebsbereit bleiben. Es ist Nachmittag und deshalb verhältnismäßig ruhig im Krankenhaus. Erst am frühen Abend und in der Nacht herrscht Hochbetrieb: Dann kommen bis zu 70 Patienten.
Ich war von der Leistung des Krankenhaues und seines gesamten Personals sowie von dem Ethos, von dem diese Menschen ihre Motivation beziehen, sehr beeindruckt.
Sonnabend, 21.5. – der Tag der langen Busreisen-Golanhöhen-See Genezareth
Wir fuhren bis auf die Golanhöhen. In dem Grenzgebiet wohnen ebenfalls Drusen. Sie leben in einem Dorf am Berg Hermon. Dieses Gebiet wurde von Israel nach dem Jom Kippur-Krieg annektiert.
Im Vergleich zu dem ersten von uns besuchten Drusendorf empfand ich die Haltung der Bewohner, die Atmosphäre dieses Mal als angespannt. Obwohl ganz offensichtlich der Ort von den aus Israel kommenden Touristen profitiert – es kamen mit und nach uns weitere Touristengruppen in die Lokale zum Essen und im nahe gelegenen Supermarkt kauften englisch sprechende Touristen ein – sagte der junge Restaurantbesitzer, er und
seine Dorfmitbewohner würden Israel als Besatzungsmacht empfinden – sie seien syrische Drusen. Und er präsentierte uns die Flagge des Drusenstaates, der in den 1920er Jahren als autonomer Teilstaat im Südwesten Syriens existierte.
In dem Moment war ich etwas irritiert, denn eine eigene Flagge bedeutet nach meiner Vorstellung auch, daß es dazu ein Gebiet geben muß mit einer gewissen Autonomie.
Diesen Teilstaat gab es auch; er wurde von der französischen Mandatsverwaltung eingerichtet. Nach politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen wurde das Gebiet jedoch vollständig vom restlichen Syrien wieder einverleibt. Ich kann mir die Äußerung des jungen Restaurantbesitzers nur so erklären, daß den Drusen in Syrien diese historische Entwicklung wohl bekannt war, sie sich aber im Laufe der Jahrzehnte als syrische Staatsbürger empfanden und als solche eben loyal zur syrischen Regierung standen und eben noch stehen. Wie ich bereits erwähnte, die Drusen sind ein loyales Volk – wohl auch ein Ergebnis vieler Jahrhunderte dauernden Lebens als Minderheit – und deshalb wohl überlebenswichtig. Das Dorf ist ein aufstrebender Ort: schön gestaltete Häuser, eine rege Bautätigkeit, viele Geschäfte und ein ständiger Touristenstrom bevölkert Cafes und Restaurants.
Ich erinnerte mich an die Ausführungen unseres Reiseleiters vor zwei Jahren – wir besuchten auch dieses Dorf und das Land drumherum, und er erzählte uns, daß die Bewohner dieser Grenzgegend von Obstanbau leben würden. Zweimal im Jahr wäre die Grenze zu Syrien offen, und die Bauern hätten die Gelegenheit, ihre Ernte nach Syrien in Kühlhäuser oder zur Küste zu bringen. Bei diesen Gelegenheiten besuchten sich die Familien auch; es wurden Hochzeiten vereinbart und gefeiert. Die Obstplantagen – viele Kirschbäume – sind noch da. Aber durch die Kämpfe um die Vormachtstellung in diesem Gebiet zwischen der Assad-Armee, IS-Anhängern und Hisbollah-Milizen ist die Lage so unsicher, daß die Bauern ihre Produkte zwar nach Israel liefern können, aber die Verwandtschaftsbesuche können nicht mehr stattfinden. Diese strikte Teilung ist für die Drusen nur schwer erträglich.
Wir fuhren dann in den Tel Dan-Nationalpark – benannt nach dem Stamm Dan. Diesen Namen trägt auch einer der Quellflüsse des Jordan. Der Dan ist der größte und wichtigste Quellfluß. Er entspringt am Fuße des Berges Hermon aus unzähligen kleinen Bachläufen. Dank guter klimatischer Bedingungen wächst hier eine üppige Vegetation: Lorbeer, Kreuzdorn, syrische Esche – ein Baum, der bis zu 20 Metern hoch werden kann. Ich habe aber keine Tiere gesehen – das mag wohl daran liegen, daß die große Zahl der Besucher die Tiere veranlaßt, sich abseits der angelegten Wege im Dickicht zu verkriechen.
Im Park befinden sich historische Stätten mit Tempelanlagen, die nach dem Tode König Salomons – als das Reich geteilt wurde in Judäa im Süden und Galiläa im Norden – gebaut wurden; denn der Tempel in Jerusalem war der Nordbevölkerung nicht mehr zugänglich.
Die Reste mächtiger Festungsmauern sind zu sehen. Besonders sehenswert ist der Hohe Platz aus der Zeit des Königs Jerobeam. Er ist eine Kultstätte – die Fundamente der Tempelanlage mit Opferaltar und den Resten der Wohnungen der Priester sind erkennbar.
Nach dem Rundgang fuhren wir weiter in den Golan hinein, ins Kibbuz La Ron. Wir sahen einen kurzen Dokumentarfilm zum – hier im Norden besonders verlustreichen – Jom-Kippur-Krieg (Zwei-Frontenkrieg im Oktober 1973). Eines der schwer umkämpften Gebiete war Emek habacha – das Tal der Tränen, wie es seit den Kämpfen heißt. Die israelische Armee eroberte in harten Auseinandersetzungen die strategisch wichtigen Golanhöhen zurück und hält sie seitdem auch besetzt. In Originalaufnahmen von Kriegsberichterstattern wurden die entscheidenden Tage dargestellt.
Danach ging es zurück in das Kibuz De Ganya, dem ältesten Kibbuz in Israel. Es wurde mit der ersten Besiedlungswelle Palästinas im Jahre 1916 gegründet.
Die Gründungsurväter müssen stramme Sozialisten gewesen sein, denn obwohl wir am Freitagabend zurückkamen, war von feierlicher Schabbatstimmung nicht viele zu merken im Dining Room.
An dieser Stelle möchte ich – trotz meiner dürftige Kenntnisse über die Kibbuzim, ihrer Organisation und ihre Bewohner – etwas über jene Kibbuzim berichten, die ich kennenlernte.
Ich habe auf dieser meiner zweiten Reise drei Kibbuzim kennengelernt: Mashabei Sade, Sde Boker und De Ganyiia. Das Kibbuz Mashabei Sade empfand ich als ein modern organisiertes Kibbuz. Und es scheint mir auch eine wohlhabende Gemeinschaft zu sein, nicht zuletzt dank des erheblichen Gästestroms. Als wir ankamen, standen bereits mehrere Busse von Übernachtungsgästen dort und am nächsten Tag kamen neue Busse. Der Dining Room war – wie wohl meistens in den Kibuzzim – zweckmäßig eingerichtet, aber hell und freundlich. Es waren Bewohner des Kibbuz da, die beim Geschirrabräumen halfen. Die Speiseauswahl war gut und wohlschmeckend.
Das Kibbuz Sde Boker, welches wir im Anschluß an die Wüstenfahrt nur sehr kurz und von außen besuchten, machte einen sehr gepflegten Eindruck. Das lag bestimmt nicht zuletzt daran, daß eben hier der erste Ministerpräsident des Landes, Ben Gurion, lebte und auch nach seiner aktiven politischen Zeit Staatsgäste aus aller Welt empfing.
De Ganya ist, wie bereits erwähnt, ein traditionsreicher Kibbuz. Mir schien die Zeit hier etwas stehen geblieben zu sein. Auf dem Weg zum Dining Room kam ich an etlichen offensichtlich verlassenen und auch etwas vernachlässigten Häusern vorbei.
Wir wohnten in einem historisch vorbelasteten Haus, dem Haus der Pioniere. Es ist wohl eines der ersten errichteten Häuser des Kibbuzes. Was diesen Kibbuz für mich aber einzig machte, war der wunderbare alte Bau- und Pflanzenbestand: Über zehn Meter hohe Kakteen, riesige Dattelpalmen, mir unbekannte Blumenbüsche, seltene, bunte Vögel nisteten in den Büschen und Bäumen – es war mir eine Freude, in der Dämmerung durch das Gelände zu gehen.
Eines würde ich jedoch sehr begrüßen: Die Essensausgabe sollte gästefreundlicher organisiert sein, das Entsorgen der Essenreste in Bottichen und das Einstapeln des schmutzigen Geschirrs durch die Gäste in die Waschstraße ist nicht mehr ganz zeitgemäß und – der Koch sollte zu einer Fortbildung geschickt werden.
Sonntag, 22.5. 16, Givat Haviva-Tel Aviv
Wir verließen De Ganiya und besuchten das jüdisch-arabische Friedens- und Begegnungszentrum Givat Haviva, welches sich um den Dialog zwischen Juden und Arabern bemüht. Leiter der Einrichtung ist ein arabischer Israeli, Herrn Samer. Nach kurzer Vorstellung seiner Mitarbeiter und Darstellung über die Ziele der Einrichtung führte er uns durch das Zentrum und erzählte dabei aus seinem Leben: In seiner Jugend war er als Araber auch Diskriminierungen ausgesetzt. Diese Erfahrungen brachten ihn zu der Überzeugung, sich für den Abbau von gegenseitigem Mißtrauen und Diskriminierungen einzusetzen.
In Tel Aviv leben heute noch viele Palästinenser, denn es sind bei Staatsgründung ca. 150 Tausend in Jaffa/TelAviv geblieben – seine Familie blieb auch. Sie wurden alle Israelis.
In den Folgejahren bemühte sich die israelischen Regierungen nach einer Meinung nicht genug um eine tatsächliche Gleichstellung von Juden und Arabern. Das Schulsystem ist immer noch geteilt: Arabische Kinder gehen in arabische Schulen, jüdische in jüdische Schulen. Die arabischstämmigen Kinder lernen erst in der dritten Klasse hebräisch. Und erst bei Beginn eines Studiums gehen die jungen Menschen einen gemeinsamen Bildungsweg. Damit würde die Chance verpaßt, das Zusammengehörigkeitsgefühl schon im Kindesalter zu fördern.
Ich halte diese Einschätzung für richtig – seine weiteren Klagen über die ungleiche Chancenverteilung, über fehlende staatliche Unterstützungen für die arabischen Familien, über Diskriminierungen im alltäglichen Leben sind sicherlich nicht nur persönliche Erfahrungen, sie werden auch realiter bestehen. An dieser Stelle bin ich auch etwas skeptisch: Es ist nach meiner Meinung keine Frage, daß in der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein von staatlicher Seite die Integration der arabischen Altbevölkerung nicht gerade eine Herzensangelegenheit war. Auf der anderen Seite ist Integration eine wechselseitige Beziehung – es müßte auch ein Wille und – ein Widerstände überwindendes – Bemühen von Seiten des arabischen Bevölkerungsanteils da sein.
Es gibt lt. Herrn Samer auch gemischte Schulen – leider konnte ich nicht erfahren, wie viele Schulen es davon gibt, und wie sie von beiden Bevölkerungsteilen angenommen werden.
Das Begegnungszentrum wird auch von nicht-regierungsgebundenen Organisationen (NGOs) aus den USA und Europa- auch aus Deutschland – unterstützt.
Schwerpunkt israelischer Bildungspolitik ist nach Herrn Samer, der Gedanke, daß arabische Kinder hebräisch lernen sollen, in jüdische Schulen die Kinder aber nicht angehalten werden, arabisch zu lernen. Das verhindere schon in den Schulen eine wirkliche Koedukation.
Seine Einrichtung macht auf niedrigschwelliger Ebene Angebote zu gemeinsamen Aktivitäten von arabischen und jüdischen Familien, für Frauen, Jungen und Mädchen. Durch die gemeinsamen Treffen wird gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis geweckt. Die Stiftung arbeitet auch daran, Schullehrpläne für eine gemeinsame Schulerziehung zu erstellen.
Mein Fazit aus dem Besuch ist zwiespältig: Herr Samer beklagt gewiß zu Recht die nicht hinreichenden staatlichen unterstützenden Maßnahmen zur Integration, zur Gleichberechtigung – insbesondere in der Vergangenheit. Das ist ein Problem, daß anderen Ländern bekannt sein dürfte: den Niederlanden, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Schweden usw. Vergleiche sind nicht angebracht – historische Ursachen, unterschiedliche wirtschaftliche, politische Entwicklungen lassen das nicht zu. Die Herausforderungen, die sich an Staaten stellen, wenn sie viele fremde Menschen aufnehmen – seien es Gastarbeiter, Flüchtlinge oder Asylsuchende – oder wenn sie große Minderheiten haben, sind aber in den Grundzügen gleich und bedürfen ähnlicher Lösungen.
Danach fuhr die Gruppe in das Altersheim „Pinchas Rosen“ in Ramat Gan. In Israel werden die Altenheime Elternheime genannt. Das Heim gehört zur Association of Israelis of Central European Origin. Diese Gesellschaft besteht seit 75 Jahren. Ihr übergeordnetes Ziel ist es, das deutschsprachige Erbe zu bewahren. Deshalb unterstützt die Gesellschaft auch Elternheime, in denen viele alte Menschen wohnen, die Überlebende des Holocaust oder Nachkommen von Israelis mitteleuropäischer Herkunft sind. Die alten Herrschaften können daher – so wie ich es mitbekam – alle Deutsch. Wir hatten am Tisch zwei alte Damen, die als kleine Mädchen nach Israel kamen. Brief und Bilder haben wir an die Beiden geschickt, und sie haben sich bereits telefonisch bedankt.
Wir werden den Kontakt mit Judith Friedländer und Lore Wolf aufrechterhalten.
Montag, 23.5.16, Besuche in und um Tel Aviv
Schon bei der Anfahrt auf Tel Aviv fiel mir die umfassende Bautätigkeit in der Stadt und ihrer Umgebung auf: Baukräne bestimmten die Silhouette.
Als erstes war heute die Stadt selbst das Programm: Besichtigung durch die Stadtteile Sarona und die Weiße Stadt oder wahlweise Stadtbummel standen zur Wahl.
Sarona war eine Siedlung der Templergesellschaft, die sich 1868 nach Palästina aufmachte, um dort das Christentum zu verbreiten. Es gibt auch Überreste von weiteren Siedlungen dieser Gesellschaft in Haifa und Jerusalem. In Tel Aviv ist Sarona ein Teil der Stadt. Er wird aufwändig restauriert und zu einem Touristenmagneten entwickelt mit Gewerbeflächen für elegante Geschäfte und Gastronomie.
Die Weiße Stadt Tel Avivs ist ein Weltkulturerbe. Sie entstand in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ihre Architekten waren junge jüdische Architekten (Arieh Sharon, Shlomo Bernstein, Richard Kauffmann u.a.m.), die ihre Ausbildung im Bauhaus Dessau erlebten. Ihre Lehrer waren Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Mies van der Rohe oder Le Corbusier.
Die meisten Gebäude wurden in den folgenden Jahrzehnten sehr vernachlässigt, einige Gebäude mußten sogar abgerissen werden. Um dieses architektonische Kleinod wenigstens teilweise zu erhalten wurden 2009 erst rund 1.000 Häuser unter Denkmalschutz gestellt; mittlerweile sind es über 4.000 Häuser, die zum Weltkulturerbe gehören. Auch diese Sanierung des Stadtteils kostet Tel Aviv sehr viel Geld – es ist als Ensemble aber einzigartig. Es gibt aber auch in Jerusalem etliche Häuser im Bauhaus-Stil.
Da ich auf unserer vorigen Reise eine Führung durch die Weiße Stadt mitmachte – unter der Führung einer sehr kompetenten Architektin und Sanierungsbeauftragten für das Projekt, Frau Sharon Golan Yaron, war für dieses Mal ein Stadtbummel durch weniger bekannte Stadtteile angesagt.
Danach besuchten wir gemeinsam die deutsche Botschaft in Tel Aviv. Der Botschafter, Herr von Goetze, war in Jerusalem und deshalb empfing uns die Gesandte, Frau Iversen, die seit zwei Jahren an der Botschaft tätig ist. Sie schilderte die aktuelle, schwierige, innenpolitische Lage, z. B. das – auch international umstrittene – Vorhaben der Regierung, die sogenannten „linken“ nicht-regierungsgebundenen Organisationen durch Kontrollgesetze strenger an die Kandare zu nehmen als auch das Suspendierungsgesetz, mit dessen Hilfe Abgeordnete der Knesset entlassen werden können. Die deutsche Botschaft sieht es als eine ihrer wichtigen Aufgaben, das Bild Israels in der Europäischen Union fair darzustellen und dem extrem Israel-kritische Verhalten entgegenzuwirken, Verständnis für Maßnahmen Israels – auch in den besetzten Gebieten – zu wecken, zugleich aber auch den Gesprächsfaden mit den Palästinensern nicht abreißen zu lassen; ein schmaler Grat.
Mir scheint überhaupt, daß alle politischen Akteure, sozialen Einrichtungen, wirtschaftlichen Vereinigungen, die Armee, in diesem Land alltägliche Gratwanderungen unternehmen, um diesem Teil des Nahen Ostens einen Anstrich von Stabilität und Kontinuität zu geben.
Dazu zählt auch die nächste Einrichtung, die wir besuchten, die Israelisch-Deutsche Gesellschaft (IDG) im Sharbat House. Unsere Gesprächspartner waren Herr Grisha Alroi Arloser – er ist der Vorsitzende der IDG und zugleich der Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Handelskammer sowie weitere Mitglieder des Vorstands der IDG. Dazu zählt auch Herr Emanuel Shahat, der Vizepräsident der IDG; er ist Experte für den asiatischen Handelsraum. Während in Deutschland die DIG über 5.000 Mitglieder zählt, ist die Israelisch-Deutsche Gesellschaft eine eher überschaubare Vereinigung. Sie wurde gegründet ein Jahr nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten ist die Pflege und Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Dieses Ziel verbindet die Gesellschaft mit ihren Aktivitäten, ein realistisches Bild über die wirtschaftlichen gesellschaftlichen, sozialen Verhältnisse in Israel und Deutschland zu vermitteln. Der Vorsitzende der IDG betont, daß sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern positiv entwickeln. Die anwesenden Vertreter der IDG sind – gut nachvollziehbar – nicht nur Mitglieder der Gesellschaft, sondern auch Mitglieder der Handelskammer in Israel und zwischen den Außenhandelskammern beider Länder herrscht reger Gedankenaustausch. Befragt auf wirtschaftliche Beziehungen zu Palästina sagten unsere Gesprächspartner, es gebe Kontakte; insbesondere sind Fragen der Wasserversorgung und der Elektrizitätsversorgung Gegenstand von Gesprächen. Auf Fragen zur Arbeitslosigkeit in Israel wurde uns die nahezu konstante Quote von rd. 6 % genannt. Die – auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung behauptete – Arbeitslosenquote von 95 % in Ostjerusalem konnte unser Gesprächspartner nicht nachvollziehen. Er hielt diesen Prozentsatz für entschieden zu hoch gegriffen. Angesprochen auf die Kampagne der besonderen Kennzeichnungspflicht von Produkten aus israelisch besetzten Gebieten (Westbank, Golanhöhen, Ostjerusalem) hält er diese für eine Farce. Schon lange würden die Produkte ihrer Herkunft nach gekennzeichnet. Die Organisation BDS (Boykott, Divestments and Sanctions) ist in seinen Augen keine Friedensbewegung sondern eine antisemitische Organisation.
Diese Ansicht teile ich. Schon die Übersetzung zeigt klar, wohin der Hase laufen soll: Boykott, Kapitalabzug und Sanktionen – das sind die Ziele der Organisation. In ihr sind sehr eifrige und einflußreiche Verfechter zu finden, die jedes Friedensabkommen mit Israel ablehnen. Daß die EU diesen Israelhassern auf den Leim gegangen ist mit ihrem Kennzeichnungsbeschluß wurde nicht nur in der deutschen Presse heftig als töricht und kontraproduktiv kritisiert. Dem Friedensprozeß zwischen den Palästinensern und den Israelis dient dieser Beschluß jedenfalls nicht.
Am Abend gab es noch ein sehr beeindruckendes Treffen mit einem Überlebenden des KZ Auschwitz: Herrn Noah Klieger. Herr Klieger wird Ende Juli 90 Jahre alt. In dem Gespräch mit ihm wurde für mich deutlich, was ich bei vielen Gesprächen mit Überlebenden des Holocaust erfuhr: Es existiert kein Haß gegenüber Deutschland – eher Trauer um eine verlorene Zeit.

Herr Klieger ist gewiß zu alt, und die Strapazen einer Deutschlandreise sind nicht mehr zumutbar. Aber Gespräche mit Überlebenden wie ihm sind insbesondere für junge Deutsche bestimmt beeindruckender und wirken nachhaltiger als jedes Buch über die Schreckenstaten im Holocaust.
Etliche Mitreisende ließen den Tag ausklingen mit einem Blick über Tel Aviv von der Dachterrasse des Hotels. Das war ein schöner Reiseabschluß.
Dienstag, 24.5.16
Check out – Abflug vom Flughafen Ben Gurion.
Es gab wieder eine Verspätung: Der Busfahrer hat das Hotel nicht finden können –Naomi half. Die Ankunft auf dem Flughafen war aber zeitig genug für die Abfertigung zum Abflug. Naomi begleitete uns, bis wir in der richtigen Schlange zur Abfertigung standen und mußte sich sputen, um die nächste ankommende Gruppe zu begrüßen.
Naomi wird im August nach Berlin kommen – dann sieht sich die Gruppe wieder. Ich freue mich darauf!
Das war nun mein Bericht von der Reise mit Mitgliedern und Freunden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft vom 15. Mai 2016 bis zum Dienstag, 24. Mai 2016.
Reisebericht der Israelreise vom 15.5. bis 24.5.2016
von Brigitte Vornehm-Berger
DIG Mitglied in Bonn
15.05.2016
Anreise aus Frankfurt mit El Al.
Am Flughafen Ben Gurion finde ich schnell die DIG Gruppe, die aus Berlin angereist ist. Wir fahren mit dem Bus nach Jerusalem und wohnen im Eldan Hotel, 24 King David Street.
Nach dem Abendessen folgt (im 2. Untergeschoß) ein Gespräch mit Arye Sharuz Shalicar, Pressesprecher (mit Europabezug) der Israelischen Armee.
Er fasst seine Erfahrungen in Deutschland, insbesondere Berlin-Wedding, zusammen und geht dann auf die Sicherheitslage Israels ein.
16.05.2016
Fahrt ins Westjordanland Richtung Süden, vorbei an einem Ort namens Efrata zum palästinensisch-jüdischen Verständigungsprojekt „Friends of Roots“, das zwischen Bethlehem und Hebron liegt. Das Ressort wirkt ländlich, spartanisch.
Wir treffen zwei der Gründer von Friends of Roots, Ali Abu Awwad und Shaul Judelman.
Ali Awwad erzählt seine Lebensgeschichte und seinen politischen Werdegang. 1972 geboren folgte er der Tradition seiner Familie, die er als „Flüchtlingsfamilie“ bezeichnet und die der PLO und Arafat nahestand. Die Jugend sei von Entbehrungen und Gewalt geprägt gewesen. Er gehörte schon in jugendlichem Alter in der Fatah an und nahm auch an Terrorakten teil – ebenso wie seine Mutter. Die Mutter sei aus diesem Grund in Israel zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. 1990 sei auch er festgenommen und zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Im Gefängnis (1993) habe er mit einem Hungerstreik erzwungen, die ebenfalls inhaftierte Mutter sehen zu dürfen. Dies nennt er seine erste Erfahrung des Erfolgs mit „gewaltlosem Widerstand“. Fortan habe er sich mit den Theorien und Lehren des gewaltlosen Widerstands beschäftigt, Gandhi, Martin Luther King, Mandela und andere gelesen. Die in dieser Zeit stattfindenden Oslo-Verhandlungen seien ebenfalls für sein Denken prägend gewesen. Nach einem medizinischen Aufenthalt im Ausland in der Zeit der zweiten Intifada sei sein Bruder an einem Checkpoint durch einen israelischen Soldaten zu Tode gekommen. Dieser wurde dafür allerdings zur Verantwortung gezogen.
Die trauernde Mutter habe damals ihre Einstellung geändert. 2002 kam er auf Initiative der Mutter mit einer von einem jüdischen Siedler gegründeten Trauer-Organisation zusammen. Hier begegnen sich Palästinenser und Israelis, die im Rahmen des israelisch-palästinensischen Konfliktes ein Familienmitglied verloren haben. Motto des Forums: Dialog statt Gewalt. Ali Awwad sagt von sich, er habe hier zum ersten Mal begriffen, dass Juden genauso unter dem Verlust eines geliebten Menschen leiden wie Araber. Diese Erfahrung habe ihn in seinem Entschluss bestärkt, künftig den gewaltfreien Weg zu wählen.
Er habe begonnen, gegenüber Männern, Frauen, Kindern in Palästina und anderswo Vorträge über die Lehre des gewaltfreien Widerstandes eines Martin Luther King, eines Nelson Mandela u. a. zu halten. Politisch fordere er von den Arabern, sich nicht länger in der Opferrolle einzurichten, sondern den ewigen Teufelskreis von Verlust, Leid und Rache zu verlassen.
Im Jahr 2010 sei er aus dem Forum ausgeschieden und habe mit anderen die israelisch- palästinensische Initiative “Leading Leaders for Peace” gegründet. Damals sei auf dem Familiengrundstück zwischen Bethlehem and Hebron dieses Friedenslager für Gewaltfreiheit und Dialog entstanden. Dann Anfang 2014 habe er zusammen mit Shaul Judelman und Rabbi Hanan Schlesinger die Organisation „Roots“ gegründet, die er als eine israeli-palestinensische Initiative bezeichnet, die die örtlichen Gemeinden und ihre Führer vom Weg des Dialogs statt Gewalt überzeugen wolle. Er reise zu diesem Zweck auch in die USA, um für seine Haltung zu werben.
Er sieht sich inzwischen in deutlicher Distanz zur Fatah und zur PLO. Deren Korruption in Palästina betrachtet er als eines der Hauptprobleme. Er betonte, die Palästinenser sollten nicht nur Korruption in Israel und der westlichen Welt anprangern, sondern vor allem die Korruption im eigenen palästinensischen Lager bekämpfen.
Auch kritisiert er die Entwertung der Oslo-Vereinbarung und die Neigung der Palästinenser, das Existenzrecht Israels zunehmend zu bestreiten, die Araber als leidende Opfer darstellen, aber „the Jewish fear“ nicht wahrnehmen zu wollen. Er rufe immer wieder auf, die „Nakba heilen“ (seine Wortwahl) könne man nicht durch Gewalt, sondern nur durch Partnerschaft und Verständigung. Leider mangele es aber sowohl Palästina als auch Israel an den richtigen Führungspersönlichkeiten, um den Verständigungsweg zu beschreiten. Weder Netanyahu noch Abbas seien wirkliche „leader“, hätten Visionen vom Frieden.
Ali Awwad erzählt stolz, er habe seit Bestehen von „Friends of Roots“ fast 14.000 Besucher empfangen. Er habe Kontakte zu beiden politischen Kontrahenten, werde aber von beiden Seiten offiziell beschwiegen. Dennoch träume er davon und hoffe, dass er Hunderttausende Palästinenser vom Weg der Gewaltlosigkeit und des Dialogs überzeugen könne.
Shaul Judelman ist ein jüdischer Siedler, der das Projekt zusammen mit Ali Abu Awwad betreibt. Shaul siedelte im Jahr 2000 aus den USA über nach Israel. Sein Lebensweg führte ihn über ein Kibbuz, ein religiöses Seminar, ein Shabbat-Jahr zu Roots. Er habe zu Fragen des Nahostkonfliktes anfangs weit rechts gestanden. Er begriff allmählich, dass zwar 80 % der Israelis eine Zwei-Staaten-Lösung befürworteten, diese aber nicht zu ihren Lebzeiten wünschten, weil Angst das Land beherrsche. 65 % der Israelis hätten Angst vor Anschlägen. Überall im Land habe sich Misstrauen gegenüber Palästinensern ausgebreitet. Auch er habe Gewalt erlebt. Dennoch habe er langsam begriffen, dass 90 % der Palästinenser nicht in Gewalt verstrickt seien. Auf der anderen Seite wurde ihm bewusst, dass religiöse Fanatiker in Israel mit Überheblichkeit auf Palästinenser reagierten. Deshalb sei er zu der Auffassung gelangt, dass Religionen den Friedensprozess vergiften, wenn statt einer „religion of books“ (Buchstabenreligion) eine „religion of land“ gepredigt werde. Dies gelte sowohl für die jüdische als auch die muslimische Religion.
Darüber hinaus kritisiere er die wechselseitige Nichtanerkennung von Identität, d.h., dass viele Palästinenser nicht die Identität der Juden und umgekehrt Juden nicht die Identität der Palästinenser anerkennen. Beide Seiten würden sich gegenseitig als Kolonialisten verdächtigen und beschimpfen – dies sei Identitätsverweigerung und traumatisiere die Menschen beider Nationen.
Vor ca 3 Jahren lernte Shaul bei Rabbiner Menachem Froman Ali Awwad in einem Sommer-Camp kennen. Seither arbeite er mit ihm zusammen, weil er überzeugt sei, dass man den Friedensprozess „von unten aufbauen“ müsse.
Die beiden Gastgeber verabschieden sich mit den Worten:
„Leadership is an art of humanity –
I don’t want to be right, I want to succeed.“
Der weitere Weg führt uns zur Hebräischen Universität (HUJ). Dort lassen wir von Sabina Gass, zuständig für Gäste der HUJ, auf deutsch deren Geschichte und das architektonische Konzept erläutern. Auf dem Mount Scopus sind drei Fakultäten untergebracht, Humanwissenschaften, Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaften. Die Studentenschaft ist international, der Unterricht findet teilweise auf Englisch statt.

Die Universität wurde 1925 gegründet. Nach dem Krieg 1948 wurden die Juden aus Jerusalem vertrieben, der Weg auf den Campus war lebensgefährlich, daher wurde er geschlossen. Erst nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 zog wieder Leben in diesen Teil der Uni ein.
Wir treffen dann Studenten, die wenige Wochen zuvor in Berlin gewesen waren und die SPD-Abgeordnete Edelgard Bulmahn getroffen hatten. Die Erinnerung der Studenten an das Gespräch mit der Politikerin wird mit höflichen Worten als ‚kritisch’ beschrieben. Zitat aus dem Tagesspiegel vom 04.05.2016: „Ich glaube, die Sachen, die sie gesagt hat, waren sehr naiv und problematisch“, fasste eine Studentin die Diskussion zusammen. Von außen sei es einfach, neutral zu sein und zu sagen, beide Seiten hätten Unrecht. „Das ist aber etwas anderes, wenn Raketen auf dein Haus geschossen werden, Leute in den Straßen erstochen werden und Busse explodieren.“ Ein anderer Student ergänzt: „Sie wollte nur einen Vortrag halten und falsche Fakten verbreiten.“ Das Gespräch sei für ihn ein weiterer Beweis für die mangelnde Kompetenz der europäischen Politik im Nahostkonflikt. Andere Teilnehmer teilten diesen Eindruck.
Anschließend geniessen wir eine klassische Führung durch Jerusalem mit zauberhaften Ausblicken über und Einblicken in die Stadt und ihre Geschichte.
Nach dem Abendessen im Hotel Vortrag von Dr. Michael Borchard von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Gast erläutert uns seine Sicht der politischen Entwicklung im Nahostkonflikt.
17.05.2016
Am Vormittag Besuch von Yad Vashem. Schwieriger Besuch und grundnotwendig. Hals zugeschnürt, Worte finden unmöglich. Die Gedenkhalle für die ermordeten Kinder kannte ich bisher nicht. Begreifen was unbegreiflich ist. Alleinsein.
Die anschließende Pause in der Cafeteria führt wieder in das Heute zurück.
Am Nachmittag treffen wir an der Hebräischen Universität den früheren Rektor der Universität, Prof. Hanoch Gutfreund. Eine beeindruckende, bescheidene Persönlichkeit. Er schickte nicht seine Sekretärin, um uns abzuholen, sondern kommt persönlich. Er berichtet uns von den alten Beziehungen der Universität nach Deutschland, wo nach dem ersten Weltkrieg ein Verband jüdischer Akademiker zur Förderung der Universität Jerusalem (Mitglieder u.a. Einstein, Oppenheimer) entstanden war, der das Ziel hatte, in Jerusalem die Entstehung einer Hebräische Universität zu fördern. MItte der 50er Jahre begannen Wiederbelebungsversuche dieses Vereins, was sich zunächst wegen des Reiseverbots nach Deutschland schwierig gestaltete.
Die Universität feiert jetzt ihren 90. Geburtstag. Ihr erster Präsident war Chaim Weizmann. Prof. Gutfreund berichtet uns auch ausführlich mit Hilfe etlicher Bilder über das Albert-Einstein-Archiv. Es ist hier in Israel an der HUJ, weil der große Physiker ihr sein komplettes Werk vermacht hat.
Am frühen Abend Besuch der Knesset. (Staatssystem: Parlamentarische Demokratie mit vierjähriger Legislaturperiode, Gewaltenteilung, Einkammersystem, Unabhängigkeit der Gerichte mit säkularen und religiösen Gerichten). An der Spitze der säkularen Gerichtsbarkeit steht das Oberste Gericht in Jerusalem und das Hohe Gericht der Gerechtigkeit – eine Art Verfassungsgericht.
Religiöse Gerichte sind die Rabbinatsgerichte für die jüdischen Glaubensgemeinschaften, die muslimischen Religionsgerichte (Scharia-Gerichte), die religiösen Gerichte der Drusen und die juristischen Institutionen der zehn anerkannten christlichen Gemeinschaften in Israel. Sie sind zuständig für Personenregisterangelegenheiten, Scheidungen, Unterhaltsfragen usw.
Außerdem gibt es den sogenannten „Staatskontrolleur“, der von der Knesset gewählt ist.
Vor dem Abendessen haben wir Gelegenheit, vom Dach des nahegelegenen King-David-Hotels über die Stadt zu blicken.

18.05.2016
Der deutschsprachige Journalist Ulrich Sahm begleitet uns im Bus durch Stadtteile Jerusalems und nach Bethlehem und ist als langjähriger Einwohner dieser Region über vieles informiert. Daran lässt er uns teilhaben.
Wir fahren auch zum Grab von Rachel, das für die Juden ein hochrangiges Heiligtum ist. Der Zugang zum Grab sowie die Zufahrt sind von Mauern umgeben, da es in der Vergangenheit häufig Anschläge von Palästinensern auf Betende gab. Vor dem Eingang zu Rachels Grab sind noch die schwarzen Spuren von Brandbomben zu erkennen.
Bei der Weiterfahrt macht uns Ulrich Sahm am Fuß von Jerusalem auf ein Dorf aufmerksam, das bis 1948 fast ausschließlich jüdisch besiedelt war. Nach dem Unabhängigkeitskrieg (1948) haben jordanische Araber das Dorf ethnisch „gesäubert“. Vor dem 6-Tage-Krieg war auch Ostjerusalem durch die Jordanier von Juden „gesäubert“ worden, so dass es nach dem Unabhängigkeitskrieg dort kein jüdisches Leben mehr gab.
Auch Libyen und Syrien wurden ethnisch „gesäubert“. Auch dort lebt heute kein einziger Jude mehr.
Wir fahren entlang der Betarstrasse, die früher die Grenzlinie zwischen Israel und Jordanien markierte. Auf der einen Straßenseite sind jüdische Siedlungen (Dshebel, Abu Romei, Har Homar), die die UN für illegal erklärt hat. Die Siedlungen befinden sich auf Grund und Boden, den Araber den Siedlern verkauft haben. Die Siedlungen wurden dann im Jahr 2002 gebaut.
Vorbeifahrt an der Gilo-Siedlung in Ost-Jerusalem. Diese Siedlung befindet sich auf altem jüdischem Grund und Boden.
Weiterfahrt vorbei an Beth Jala, einem christlichen Dorf, das sich auf einer Anhöhe gegenüber Bethlehem befindet. Ulrich Sahm berichtet von einer Schießerei aus dem Jahr 2000. Kinder hatten begonnen, Steine auf Israelis zu werfen. Hinter den Kindern hatten sich palästinensische Schützen postiert. Im gegenüberliegenden Dorf waren israelische Soldaten. Es kam zu einer Schießerei zwischen den Palästinensern und den Israelis. Daraufhin klagte die Welt Israel an, ihre Soldaten würden auf Kinder schießen. Bundeskanzler Schröder veranlasste, dass die schwerverletzten Kinder zur Behandlung nach Deutschland geflogen wurden. Hier stellten die Mediziner dann fest, dass die Kinder nicht durch Schüsse von vorne (also von israelische Soldaten), sondern durch Schüsse von hinten (von palästinensischen Schützen) verletzt worden waren. Die palästinensischen Terroristen hatten die Kinder bei der Auseinandersetzung somit nicht geschont.
Wahlrecht der Palästinenser Ostjerusalems: kein Wahlrecht zur Knesset, aber Wahlrecht für das Oberbürgermeisteramt bzw. für die Stadtverwaltung. Die Wahl wird allerdings weitgehend boykottiert, so dass die Verwaltung im Ergebnis vom jüdischen Bevölkerungsteil bestimmt wird.
Nach den Oslo-Verträgen können die Araber Jerusalems das Parlament in Ramallah mit wählen. Die letzte Wahl fand allerdings 2006 statt.
Die Jerusalemer Araber haben einen israelischen Personalausweis und einen jordanischen Pass für Auslandsreisen (in Jordanien nur eingeschränkt gültig). Auslandsreisen müssen Westjordan-Araber über Jordanien unternehmen.
1948 lebten in Bethlehem und Umgebung überwiegend Christen (80%). Brandstiftungen und anderen Formen der Verfolgung führten zur Flucht der meisten Christen, so dass die Stadt heute überwiegend muslimisch ist.
Bethlehem ist teilweise von einer Mauer, teilweise von einem Zaun umgeben, der mit einer Meldeanlage ausgerüstet ist. Es existieren keine Selbstschussanlagen, wie von BDS-Anhängern behauptet wird.
Die Grenzsicherungsmauer wurde seit dem Jahr 2003 als Reaktion auf die zunehmenden Anschläge von palästinensischen Terroristen auf Israelis gebaut. Ariel Sharon wollte damit das Eindringen von Terroristen nach Israel unter Kontrolle bekommen und Terroranschläge auf israelischen Boden verhindern oder zumindest eindämmen. Das Blutvergießen wurde im Ergebnis damit tatsächlich erheblich verringert.
Zur palästinensischen Kritik am Verlauf der Mauer und der anderen Grenzbefestigungen sowie der angeblichen Behinderung der Palästinenser in ihrer Bewegungsfreiheit weist Sahm darauf hin, dass es vor dem Sechstage-Krieg 1967 nie eine Grenze zwischen Israel und dem heutigen sogenannten Westjordanland gab, sondern lediglich eine Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Jordanien. Die Grenze sei im Übrigen derzeit relativ durchlässig. Täglich kommen 100 000 palästinensische Tagelöhner über die Kontrollpunkte nach Israel. Palästinensische Produkte werden unter israelischer Kontrolle in alle Welt exportiert. Die weitere Entwicklung der Durchlässigkeit hängt davon ab, wie stark die Terrorgefahr um sich greift.
Zwischen Jerusalem und Hebron verläuft die Hebronstrasse als Hauptverbindung zwischen Nord und Süd. Teilweise wurden auf Wunsch von Arafat Parallelwege gebaut. Die Verkehrsteilnehmer haben israelische und palästinensische Nummernschilder, wie wir sehen können.
Bethlehems Wirtschaft lebt von der Produktion des sogenannten Jerusalem-Steines und vom Tourismus (Geburtskirche). Bethlehem ist reines A-Gebiet, d.h. unter rein palästinensischer Verwaltung.
Wir halten an dem Flüchtlingslager Daheische. Die Häuser unterscheiden sich von den anderen Gebäuden durch die Bauweise: Steinbauweise bzw. Beton, kein Jerusalemstein. Viel Müll und Verschmutzung, aber die Strasse ist nicht morastig, sondern asphaltiert. (Ich vergleiche unwillkürlich mit einem normalen Wohngebiet in Luxor/Ägypten, wo die Strassen aus Morast bestehen, kaum Autos existieren und die Leute viel ärmer wirken.) Es kommen Autos (ältere Modelle) aus der Strasse von Daheische und es biegen Autos ein. Auf der Strasse treiben sich viele Kinder (Knaben) herum, kindliches Spielen ist unter ihnen aber nicht vorherrschend.
Vor einer Mädchenschule der UNRWA kommen uns Mädchen entgegen, die freundlich ihre Englischkenntnisse vorführen. Auf der anderen Seite kommen Knaben, die Steine nach uns werfen. Davor an einer Mauer das schwarz gezeichnete Potrait von Ajat al-Akrasch mit Waffe. Ajat al-Akrasch war ein 17-jähriges muslimisches Mädchen, das in Jerusalem im Jahr 2001 einen Selbstmord-Anschlag verübt hatte. (Sie soll unverheiratet schwanger gewesen sein. Das Mädchen musste darum mittels Terroranschlag die besudelte Familienehre wiederherstellen.) Eine Terroristin als Vorbild für Kinder? Und die UNRWA legt die Hände in den Schoß? (Inzwischen ging die Nachricht über die Medien, die PA habe am Donnerstag, den 26. Mai 2016 eine Gedenkfeier für Akrasch abgehalten.)
Bethlehem ist reines A-Gebiet, darum ist nur palästinensische Polizei, keine israelische zu sehen. In Bethlehem gibt es sichtbar Wohlstand mit prächtigen Herrschaftshäusern und gärtnerischer Blütenpracht. Auf den Strassen viel Verkehr, moderne komfortable Fahrzeuge. Es wird viel gebaut. Ulrich Sahm zeigt uns auch das Jassir-Palace-Hotel, das 4 Swimmingpools haben soll und mit prächtigen Blumenrabatten geschmückt ist. (Wie ist das bei dm angeblichen Wassermangel möglich? Internet-Bilder aufschlussreich)
Auf der anderen Seite gibt es freilich, wie auch in kapitalistischen Ländern, bescheidene Lebensverhältnisse. Im Vergleich zu anderen Entwicklungsländern, die ich kennengelernt habe, erscheint mir der Lebensstandard hier relativ hoch.
Die geltenden Währungen sind Shekel, Dinar, Dollar
Ulrich Sahm berichtet von einem Gespräch, das er mit Joschka Fischer in dessen Zeit als Außenminister über den Beginn der 2. Intifada gehabt habe. Fischer habe sich beklagt, mit Arafat sei ab dem Jahr 2000 nicht mehr zu reden gewesen, weil Arafat nach dem israelischen Abzug aus dem Libanon die Intifada vorbereitet habe. Als Aufhänger für den ersten Anschlag nutzte Arafat einen Besuch Scharons auf dem Tempelberg. Der Besuch sei aber von Scharon zusammen mit dem Sicherheitsminister der Autonomiebehörde, Marwan Barghouti vorbereitet und abgesprochen gewesen. Später habe Baruti ausgeplaudert, Arafat habe persönlich die Intifada vorbereitet. Im Juni 2001 erfolgte der erste Anschlag auf das Dolphinarium in Tel Aviv mit mehr als 20 Toten und vielen Schwerverletzten. Die Opfer waren überwiegend aus der Sowjetunion eingewanderte junge Menschen. Scharon war daraufhin entschlossen, ins Westjordanland einzumarschieren. Joschka Fischer habe sich zu dem Zeitpunkt gerade in Israel aufgehalten und sei aus Sorge vor einer Eskalation zunächst zu Scharon, dann zu Arafat gefahren. Er habe Arafat die Verurteilung des Anschlags in die Feder diktiert, um Sharon zu besänftigen. Daraufhin habe Scharon von einem Einmarsch in Dschenin abgesehen.
Es folgten zahlreiche Terroranschläge, u. a. im Restaurant ‚Sbarro‘ in Jerusalem, im Café ‚Hillel‘ in Jerusalem, in Netanja zum Pessach-Fest. Zu der Tat bekannten sich sowohl die radikal-islamische Hamas-Organisation als auch die al-Aksa-Brigaden, der bewaffnete Arm der Fatah-Organisation von Palästinenserpräsident Jassir Arafat.
Erst im Frühjahr 2002 wurde die Militär-Operation „Schutzschild“ ausgeführt.
Zur Wasserproblematik:
Deutschland hat seit Jahren mehrere Millionen € für den Bau einer Kläranlage im Westjordanland bereitgestellt. Die Realisierung war bisher nicht möglich, weil die Autonomiebehörde sich querstellt. Hydrologen haben vorgeschlagen, die Kläranlage an die geographisch tiefste Stelle, in das Tal zwischen Jerusalem und Bethlehem zu bauen, um das Gefälle zu nutzen. Das Tal ist allerdings C-Gebiet, weshalb die PA mit der Wahl dieses Ortes nicht einverstanden ist. Der Bau der Kläranlage liegt somit auf Eis, wobei die Bundesregierung die Gelder weiterhin bereithält. Daher fließt das Schmutzwasser seit Jahren weiter ungeklärt in das darunterliegende Aquifer (Grundwasserleiter) und ins Tote Meer und verseucht dieses Gewässer. Da die Wasserversorgung aus dem verseuchten Aquifer problematisch geworden ist, liefert Israel ein Drittel mehr Trinkwasser in die Westbank, als in den Osloer Verträgen vereinbart.
Israel bietet der PA auch an, für landwirtschaftliche Zwecke zusätzlich geklärtes Wasser in die Westbank zu pumpen. Israel selbst nutzt ebenfalls ausschließlich geklärtes Wasser für die Landwirtschaft. Die PA lehnt ab.
Am Nachmittag Besuch von Qumran und Totem Meer. Badepause.
Übernachtung im Kibbuz Mashabei Sade.
19.05.2016
Wüstenfahrt
Besuch des Jugendlehrzentrums Nitzana
Halt am Kunstwerk „Way of peace“ von Dani Karavan an der ägyptischen Grenze.
Besuch im Beduinenzelt beim Beduinenstamm Azzazme.
Der Stamm hat ca 2000 Mitglieder, auch in Jordanien. Aus Ägypten sind alle Stammesmitglieder nach Israel übersiedelt, weil sie sich im Zuge der Rückgabe des Sinai um ihre Sicherheit sorgten. Heute leben die Beduinen, so berichtet er, meist in Hütten und Häusern, nicht mehr in Zelten.
20.05.2016
Fahrt nach Norden, vorbei an Be’er Sheva, an gestifteten Waldpflanzungen wie dem Botschafterforst und dem Forst der Deutschen Länder (Eukalyptus, Kiefern, Pinien), vorbei an der Beduinenstadt Rahat, vorbei am Karmel Gebirge (=Weinberg Gottes) zum Drusengebiet. Im Süden sind unterwegs abgeerntete Getreidefelder zu sehen. In Israel muss Getreide vor Beginn des Sommers (April, Mai) geerntet werden. Hauptwachstumsphase ist der Winter, weil der Regen für die natürliche Bewässerung sorgt. Ansonsten verwendet die Landwirtschaft ausschließlich Wasser aus Kläranlagen. Darüber hinaus gibt es in Israel 6 Meerwasserentsalzungsanlagen.
Wir besuchen den Drusenort Usafia-Daliat El Karmel, wo wir von einem Angehörigen der Großfamilie Halar durch das Dorf geführt werden. Die Familie kam ursprünglich aus Aleppo. und lebt überwiegend vom Handeltreiben. Wir genießen das Mittagessen in einem drusischen Privathaus eines im Ruhestand befindlichen Bankers. Das Essen ist vorzüglich.
Drusen betrachen sich nicht als Araber. Sie haben eine eigene Religion, die sich vor 1000 Jahren in Ägypten aus dem Islam entwickelt hat. Wegen ihrer Religion mussten sie nach Syrien, Libanon, Israel fliehen. Es gibt ca. 15 Millionen Drusen auf der ganzen Welt. Sie sind häufig an der weißen Kopfbedeckung zu erkennen. Die Frauen sind selbstbewusster als die muslimischen Frauen. Druse wird man nur durch Geburt, Beitritt zu dieser Religion ist nicht möglich. Frauen und Männer können Priester werden. Scheidung ist aus religiöser Sicht möglich. Drusische israelische Männer sind wehrpflichtig, Frauen nicht.
Für Drusen haben die 5 Farben der Propheten eine mythologische Bedeutung:
Als Symbol der Drusen gilt ein fünfzackiger fünffarbiger Stern. Jede Farbe symbolisiert ein Prinzip des Glaubens: Grün für Verstand [aql] als den universellen Verstand, rot für Seele [nafs] der universellen Seele, gelb für das wahrhaftige Wort [kalima], blau für die Ursache eines Wirkungsprinzips [sabq] und weiß für die Wirkung.

Weiterfahrt zum Kinderdorf Ahava Kiryat Bialik.
Das Vorläufer-Gebäude des Vereins stand in Berlin. Dort wurde nach dem 1. Weltkrieg eine Armenküche eingeführt, später entwickelte sich daraus unter der Leitung von Beate Berger ein Waisenhaus. Die Gefahr des politischen Aufstiegs der Nazis war Berger früh bewusst, weshalb sie seit 1933 immer wieder für die Ausreise der Kinder kämpfte. 1940 wurde sie zusammen mit den noch verbliebenen Kindern nach Auschwitz gebracht.
In dieser Zeit wurde in Palästina/Israel in dem Gebäude, das wir besuchen, der Kinderhausbetrieb mit den geretteten Kindern eingerichtet. Heute sind 200 Kinder aus Problemfamilien, davon 170 im Internatsbetrieb, in dem Haus untergebracht. Es wird vom Wohlfahrtministerium beaufsichtigt. Die Betreuung wird in Familienstruktur geleistet. Die meisten Kinder sind jüdisch, einige auch aus muslimisch-jüdischen Beziehungen/Ehen, einige Kinder sind aus Gaza geflüchtet.
Weiterfahrt zum Krankenhaus Galilee Medical Center in Nahariya.
Das Krankenhaus wurde in den 50er Jahren mit Hilfe des Jüdischen Nationalkongresses errichtet. Es ist nur 10 km von der Grenze zum Libanon entfernt. Geleitet wird das Haus von dem arabisch-christlichen Chefarzt Dr. M.D Masad Barhoum und dem stellvertretenden Leiter Dr. Zvika Sheleg, der uns auch durch das Krankenhaus führt. Das Personal ist multireligiös, u. a. jüdisch, christlich, muslimisch, drusisch.
Das Haus hat 700 Betten für ein Einzugsgebiet von 600 000 Einwohnern.
Das Krankenhaus wurde bekannt dafür dass es auch schwerverletzte Syrer behandelt, die anonym – zu ihrem eigenen Schutz – auf unbekannten Wegen nachts mit Hilfe der IDF von der Golangrenze abgeholt werden. Wie die Kriegsverletzten an die Grenze kommen, ist unbekannt. Die Anonymität der Syrer wird im Krankenhaus gewahrt. Die Syrer werden nach Abschluss der Therapien von der IDF nächtens zurück bis zur Grenze gebracht. Auf der syrischen Seite hat sich im Laufe des Bürgerkrieges anscheinend ein Krankentransportsystem in Richtung israelische Grenze entwickelt.
Das Krankenhauspersonal ist sich einig, dass nicht danach gefragt wird, ob der jeweilige Patient als Zivilist oder als Kämpfer verletzt wurde. Jeder Verletzte sei ein Mensch, betont Dr. Sheleg, egal woher er komme. Den Verletzten müsse man, gemäß dem religiösen Grundverständnis der Beschäftigten, die notwendige Behandlung angedeihen lassen. Bisher wurden bereits über 3000 Syrer behandelt. Die Verletzten erlangen oftmals erst hier wieder Bewusstsein. Manche sind mitunter schockiert, dass sie im Feindesland geheilt werden.
Das Galilee Medical Center in Nahariya hat bisher über 1000 Traumapatienten behandelt, die größte Zahl im Vergleich zu allen anderen Krankenhäusern weltweit. Obwohl das Krankenhaus vor dem syrischen Krieg keine Traumaforschung betrieben hatte, hat es sich inzwischen zwangsläufig zur Trauma-Experten-Einrichtung mit entsprechendem Forschungsschwerpunkt entwickelt, insbesondere in der Abteilung Neurochirurgie mit 30 neurochirurgischen Intensivbetten.
Übernachtung im Kibbutz Degania am See Genezareth.
21.05.2016
Ausflugsfahrt entlang See Genezareth, Tiberias durch das Hula Tal zum nördlichsten Punkt Israels, Metula, an der libanesischen Grenze, weiter Richtung Golan zur Jordanquelle Dan (3 Jordanquellen: Banyas, Hatsbai, Dan).
Wir wandern durch das Naturschutzgebiet des Dan und betrachten antike Ausgrabungen von jüdischen Stämmen. Die dort lebenden Stämme wurden von den Assyrern vernichtet, so dass es von ihnen keine Nachfahren mehr gibt.
An der Quelle Banyas wurde der Pan-Kult betrieben, der hellenistischen Ursprungs ist.
22.05.2016
Fahrt nach Tel Aviv, vorbei an einem Dorf beim Berg Tabor, in dem Cherkessen leben, eine islamische („Islam light“) Religionsgemeinschaft, die aus dem Nordkaukasus eingewandert ist. Die Gemeinschaft erkennt den Staat Israel an und leistet Militärdienst. Weiterfahrt vorbei an Nazareth, Afula, durch die Ebene Izra’El an Meggido vorbei. Meggido war in der Antike eine Festungsstadt zur Bewachung der großen Strassen und soll 20 mal gebaut und wiederzerstört worden sein. Lt. Johannesoffenbarung findet dort die letzte Schlacht auf Erden statt.
Wir streifen arabische Dörfer, die nahe an der Grenze zum Westjordanland liegen. In Israel war vor Jahren kurzzeitig diskutiert, diese im Rahmen einer Friedenslösung im Austausch zu Siedlungen an den zu gründenden Palästinenserstaat zu übergeben. Die arabischen Einwohner hatten aber gegen solche Erwägungen protestiert. Sie wollten ihre israelische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Naomi merkt ausdrücklich an, dass arabische Israelis ebenso wie jüdische Israelis Land erwerben können.
Givat Haviva
Besuch des Begegnungszentrums und Gespräch mit dem arabischen Israeli, Herrn Samer, dem Leiter des Erziehungsbereiches.
Er berichtet über Gründung, Werdegang und Ziele der Begegnungsstätte.
Givat Haviva wurde 1949 als Bildungseinrichtung der Kibbutz-Bewegung gegründet. Das arabisch – jüdische Zentrum für den Frieden wurde 1963 ins Leben gerufen. Ziel war und ist es, die Integration und Gleichberechtigung der arabischen Minderheit in Israel zu fördern, das Verständnis zwischen Juden und Arabern zu verbessern und Forschung zur Gesamtproblematik zu fördern. Mitarbeiter sowie Leitung sind jeweils zur Hälfte arabische und jüdische Israelis.
Die Arbeit beinhaltet mehrere Schwerpunkte: Begegnung für Kinder und Jugendliche beider Gruppen, Kunstkooperation etc. Ein Schwerpunkt ist die Förderung der arabischen und hebräischen Sprache und Kultur der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe (arabische Kinder beherrschen meist besser die hebräische Sprache als jüdische Kinder die arabische) und damit Verbesserung der Verständigungsmöglichkeiten, Informationsarbeit über die Shoa.
Herr Samer weist auf das spezifische Problem Israels hin, dass jüdische und arabische Kinder üblicherweise getrennt erzogen werden. Beide Volksgruppen besuchen voneinander getrennt jüdische und arabische Schulen, so dass sich die Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von etwa 18 Jahren nicht wirklich begegnen. Es gebe nur wenige gemeinsame Schulen im Land, die Nachfrage danach sei gering, die öffentliche Förderung ebenso. Außerdem versuchten nur wenige jüdische Jugendliche die arabische Sprache zu erlernen. Arabische Jugendliche seien hingegen gehalten, ab dem 3. Schuljahr Ivrit zu erlernen. Es gebe aber kaum Kontakte und daher kaum Gelegenheit zum gegenseitigen Sprachaustausch. So würden auf beiden Seiten die ganze Jugendphase lang Stereotypen gepflegt und gefestigt. Die Vorbehalte sieht der arabische Gastgeber bei jüdischen Jugendlichen für noch ausgeprägter als bei arabischen Jugendlichen. Diesem Phänomen versuche Givat Haviva entgegenzuarbeiten. Herr Samer, der im Bildungsschwerpunkt der Begegnungsstätte arbeitet, versuche, Kinder und Jugendliche durch unterschiedliche Veranstaltungen zusammenzubringen, das Kennenlernen zu organisieren und gemeinsame Aktivitäten von Dauer auf die Beine zu stellen. Er beobachte dabei regelmäßig, dass die Hemmschwellen anfangs sehr hoch seien, nach einer Stunde aber das Eis zu schmelzen beginne, in manchen Fällen über Volks- und Religionsgrenzen hinweg sogar vorsichtig-freundschaftliche Kontakte entstünden. Das Projekt sei allerdings erheblich unterfinanziert, da das israelische Bildungsministerium die Arbeit nicht fördere. Das Budget reiche nur für 2000 Kinder. So könne man nur zeitlich begrenzte Seminare anbieten. Eine wirkliche Verbesserung erhoffe er sich durch eine massive Ausweitung solcher Begegnungen. Seiner Auffassung nach müsse generell eine politische Entscheidung für das gemeinsame Aufwachsen von Arabern und Juden in Israel getroffen werden. Hierfür kämpfe er und veranstalte dazu Trainings-Workshops für Lehrer. Givat Haviva leiste auch Curriculum-Entwicklung für Kindergärten, Schulen und High Schools.
Die Finanzierung erfolge derzeit durch Spenden, überwiegend aus den USA. Das Projekt werde auch vom Bürgermeister dieser 150 000 – Einwohner-Region unterstützt. Dieser sei bereit, weitere Projektarbeit zu unterstützen, wie z. B. ‚women cooking for peace’, Umwelt, Tourism, Industry Thinking, u. a.
Herr Samer erzählte auch von seinem eigenen Werdegang und seinen persönlichen Erfahrungen. Er entstamme einer arabischen Familie, die 1948 nicht geflüchtet, sondern im Land geblieben sei. Er besitze somit die israelische Staatsbürgerschaft. Er habe arabische Schulen besucht und bis zum Alter von 19 Jahren keine gleichaltrigen Juden kennengelernt. Auf der Hebräischen Universität habe er anfangs Sprachschwierigkeiten gehabt.
Herr Samer spricht auch über sein arabisches Leben in Israel und entwickelt dabei eine Emotionalität, die in auffallendem Kontrast zu seinen theoretischen Darlegungen über die Arbeit von Givat Haviva steht. Bei seiner Selbstdarstellung als einer von 1,7 Millionen israelischen Arabern lehnt er jeglichen Vergleich mit den Lebensverhältnissen in anderen arabischen Staaten ab, nimmt selbstmitleidsvoll Opferhaltung an, weil er in dem von Terror gepeinigten Land des Öfteren kontrolliert worden ist. Der vor einer halben Stunde aufgetretene Verständigungsaktivist ist spurlos verschwunden. Er wirft Israel die Verweigerung von Land für Neuansiedlungen vor („Schwierigkeiten, Land zu kaufen“), zu knappe Bemessung von Mitteln für Schutzräume, die angeblich schikanösen Kontrollen im öffentlichen Raum. Lehrer, die in der Schule über die sogenannte „Nakba“ (Flucht und Vertreibung von rund 700.000 Arabern aus dem späteren israelischen Staatsgebiet 1947/1948) sprechen würden angeblich gemäß einem in dieser Legislaturperiode verabschiedeten Gesetz mit Gefängnisstrafe bedroht.
Anmerkung der Redaktion:
2010 wurde das sogenannten Nakba-Gesetz verabschiedet, das öffentliche Gedenkfeiern zur Nakba unter Strafe stellt. Von der Bestrafung von Lehrern mit Gefängnis bei der reinen Erwähnung der Nakba ist nichts bekannt.
Nach einem Rundgang durch die Einrichung fahren wir weiter nach Tel Aviv zum
Elternheim der Jeckes in Ramat Gan, einer Einrichtung des Irgun.
Irgun hat zwei Heime in Jerusalem, eines in Tel Aviv. Irgun wurde 1932 gegründet.

Unterkunft im Hotel Gilgal.
Am Abend erhalten wir Besuch des hoch betagten Holocaust-Überlebenden Noah Klieger. Er tritt uns mit großer Freundlichkeit gegenüber, obwohl er im Namen Deutschlands Bestialisches, Demütigungen, Folter, Todesmärsche u. a. erleben musste. Er sieht, wie er erläutert, seine Lebensaufgabe darin, jede Gelegenheit zu nutzen, um von seinen Erfahrungen mit den Nazis und deren Vernichtungsmaschinerie zu berichten, zumal nach seiner Erfahrung die Mehrheit der Deutschen Hitler unterstützte. In Yad Vashem sind unter den 26.000 Gerechten nur 520 Deutsche. Die Hasspredigten gegen Juden wurden aus zwei Wurzeln genährt, nämlich der seit dem 19. Jahrhundert erfundenen Rassentheorie und dem christlichen Antisemitismus, der seit Beginn des Christentums besonders in Deutschland (aber auch im übrigen christlichen Europa) wabert.
Noah Klieger ist in Frankreich geboren. Sein Vater hatte sich der belgischen Resistance angeschlossen. Er besorgte sich gefälschte Papiere, um eine Untergrundorganisation der jüdischen Jugend zu gründen. Mit ihrer Hilfe schmuggelte er Jugendliche in die Schweiz. Er beabsichtigte, als letzte Kleingruppe in die Schweiz zu flüchten und wartete im französisch-belgischen Grenzgebiet auf die Schleuser, die ihn abholen sollten. Doch die Gruppe war vor ihrer letzten Aktion verraten worden. So kam die Gestapo, die ihn im Januar 1943 im Alter von 15 Jahren nach Auschwitz transportierte.
Dort habe er mit viel Glück die Strapazen überstanden, auch weil ihn ein serbokroatischer SS-Mann von einem Lastwagen, der Schwache und Kranke geradewegs in die Gaskammer fuhr, verjagte. Die Verpflegung bestand aus schwarzer Brühe, Schwarzbrot, Schweinebrühe, synthetischer Wurst. Seines Wissens sind in dem Lager, in dem er untergebracht war, 1.200.000 Juden, 25.000 Sinti und Roma und Zehntausende politische Gefangene und Kriegsgefangene gestorben, teils verhungert. Knapp 45.000 Menschen haben Auschwitz überlebt.
Im Januar 1945 wurde er gezwungen, den Todesmarsch nach Deutschland anzutreten. Von den rund 60.000 aufbrechenden Menschen sind nur 19.000 lebend angekommen. Am 29. 04. 1945 wurden die Gefangenen von der Sowjetarmee befreit.
Später habe er sich als Besatzungsmitglied auf das Schiff Exodus begeben und diese Höllenfahrt miterleben müssen. Seit 1948 lebe er in Israel. Zum ersten Mal sei er im Jahre 1962 nach Deutschland gefahren und habe als Journalist in Frankfurt dem von Fritz Bauer vorangetriebenen Auschwitzprozess beigewohnt. Noah Klieger kritisiert die mangelhafte Aufarbeitung der Verbrechensgeschichte in der Bundesrepublik. Immerhin habe es 1.100.000 SS-Leute gegeben, von denen nur 70 vor Gericht gestellt wurden. Die meisten wurden freigesprochen. Die Gerichtsverfahren waren Farcen, zumal die Dimension dieser Verbrechen nicht außer Acht gelassen werden darf. Immerhin gab es mehr als 2000 Lager allein auf deutschem Boden.
Noah Klieger arbeitet immer noch als Journalist in Israel.
23.05.2016
Besuch bei der Deutschen Botschaft.
Gesprächspartnerin: Frau Iversen, Gesandte

Frau Iversen legt die Einschätzung der Botschaft über die israelische politische Entwicklung dar.
Sie bemängelt, es gebe in Israel zu wenige Versuche und Initiativen, das jüdisch-arabische Zusammenleben zu fördern, es gebe zuviel Polarisierung. Eine Ausnahme in der israelischen Politik sei lediglich Präsident Rivlin, der Gewaltakte von allen Seiten gleichermaßen öffentlich verurteile und Verständigungsinitiativen unterstütze.
Im März 2015 war die letzte Knessetwahl (120 Sitze). Netanjahu gewann die Wahl mit seiner Partei Likud mit 30 Sitzen, daher war eine Koalitionsfindung erforderlich. Netanjahu bildete zunächst eine rechtskonservative Koalition mit einer knappen Mehrheit von 61 Sitzen. Zum Zwecke einer breiteren Mehrheitsgewinnung führt Netanjahu in letzter Zeit Gespräche u. a. mit der Zionistischen Union (24 Sitze) geführt von Tsipi Livni und Jitzchak Herzog) einerseits und Avigdor Lieberman (Jisrael Beitenu) andrerseits. Die Gespräche mit der Zionistischen Union scheinen nicht zum Erfolg zu führen, da der Flügel der Arbeitspartei dagegen ist. Avigdor Lieberman wurde das Verteidigungsministerium angeboten. Streitpunkte waren bis zum Schluss die Frage der Todesstrafe für Terroristen, die Siedlungspolitik, die Neuaufnahme von Friedensverhandlungen und die Erhöhung der Pensionen für russische Einwanderer. Die größte Gruppe aus der Opposition (Labour) ist gegen derartige Zugeständnisse. (Inzwischen ist die Koalitionserweiterung ohne die Zionistische Union, aber mit Avigdor Lieberman abgeschlossen.)
Derzeitige politische Maßnahmen und Gesetzesinitiativen:
NGO – Gesetz: Die Botschaft sei besorgt, weil das geplante NGO-Gesetz vor allem das linke Spektrum treffe. In Israel müssen nicht-staatliche Organisationen jetzt offenlegen, ob sie Geld aus dem Ausland erhalten. Das Gesetz legt nicht alle Zuwendungen aus dem Ausland offen, sondern nur staatliche Gelder. Die Regierung will so Einmischung von anderen Staaten kontrollieren. Vor allem aus Deutschland kommt Kritik.
Der Nahostfriedensprozess ist seit 2015 zum Stillstand gekommen. Die Initiative Frankreichs von 2016, die vorbereitend die Möglichkeiten zunächst ohne Israel und die Palästinenserbehörde ausloten soll, stößt in Israel auf Skepsis. Dabei wirkt auch die Messer-Intifada destruktiv. Auf der anderen Seite macht Hoffnung, dass die Hamas derzeit schwer an Aufrüstungsgüter kommt.
Mit Jordanien und Ägypten wird weiterhin eine enge Sicherheitskooperation gepflegt. Auf den Golanhöhen wird die Lage kritischer eingeschätzt, weil die UN ihre Einheiten reduziert haben. Über den Golan werden Kontakte zur Verletztenbehandlung gepflegt, es gibt aber keine Flüchtlingsaufnahme.
Assad ist für Israel derzeit ungefährlich, weil im eigenen Land gebunden. Saudi-Arabien und die Golfstaaten arbeiten mit Israel sicherheitstechnisch „subkutan“ zusammen. Auch das Verhältnis zur Türkei normalisiert sich.
Die Botschaft betrachtet die Hisbollah jenseits der Grenze im Libanon, die vom Iran aufgerüstet wird, als die größte Gefahr. Diese hat wohl m Libanon 100.000 Raketen inmitten der Zivilbevölkerung stationiert. Die Hisbollah wartet auf grünes Licht vom Iran, um den Raketenkrieg gegen Israel zu starten. Israel befürchtet, dass der Iron Dome diese Bedrohung nicht ohne größere Schäden für das Land bewältigen kann. Insgesamt gelten Hisbollah und der Iran als die größte Bedrohung für Israel.
Von den Mitgliedern der Reisegruppe wird Kritik an der deutschen Israel-Politik formuliert. Unverständlich sei, dass die eigentlichen Ursachen für die Unzufriedenheit im Westjordanland, nämlich die ungleiche Verteilung des unermesslichen Reichtums auf der einen Seite gegenüber der verbreiteten Armut auf der anderen Seite von der deutschen Politik nicht deutlich öffentlich ausgesprochen werde. Warum verurteilen Deutschland und die EU dies nicht in aller Klarheit, zumal der größte Teil der Gelder aus der EU stammt?
Die deutsche Politik pflege eine unerträgliche Äquidistanz zu beiden Seiten, ohne die Unterschiedlichkeit von Art und Ausprägung der Gewalt zu berücksichtigen. Warum werde die Gewalt in der Westbank, deren Unterstützung durch die Autonomiebehörde, die Honorierung von Gewaltakten mittels Renten oder Honoraren durch die Autonomiebehörde nicht politisch angeklagt? Solange diese Gewaltkultur achselzuckend hingenommen wird, seien die Voraussetzungen für Gewaltfreiheit und Frieden nicht gegeben.
In gleicher Weise sei die Hasspropaganda, wie wir sie mit eigenen Augen z. B. in Bethlehem erlebt haben, für das Ziel eines Friedensprozesses nicht hinnehmbar. Wir sahen vor einer UN-Schule das Konterfei einer Selbstmordattentäterin, das den Mädchen offenbar als Vorbild vorgehalten wird. Wie ist es möglich, dass die UN und die EU so etwas hinnimmt? Wir sahen die Boykottaufrufe auf dem Hauptplatz in Bethlehem, die Konterfeis anderer Gewalttäter, die als „Märtyrer“ schöngewaschen werden. Wir erfuhren, dass der größte Teil der christlichen Bevölkerung aus Bethlehem vertrieben worden ist.
Wo bleibt die Einflussnahme der Bundesrepublik Deutschland gegen solche Entwicklungen und vor allem gegen das Wegsehen der EU?
Frau Iversen antwortet, die Stimmung in Europa sei extrem kritisch gegen Israel eingestellt, daher sei die Einflussnahme Deutschlands schwierig geworden. Deutschland versuche in der EU, die Boykottbestrebungen zu bremsen.
Die Botschaft in Tel Aviv sei aber für die Palästinensische Autonomiebehörde nicht zuständig. In Ramallah gebe es eine eigene Vertretung.
Anschließend an den Besuch bei Givat Haviva wird die Frage nach Schulbüchern gestellt. Neue Schulbücher und Staatsbürgerkunde seien derzeit in Israel ein großes Thema, erläutert Frau Iversen. In Staatsbürgerfragen sei die arabische Minderheit bereit, sich zu arrangieren.
Fragen zur Wasserpolitik und zum Bau von Kläranlagen kann Frau Iversen nicht beantworten. Sie halte aber die Angaben über Wasserlieferungen auf der Homepage der israelischen Botschaft für zuverlässig.
Am Nachmittag Besuch von Jaffa und danach der Israelisch-Deutschen Gesellschaft gemeinsam mit der Israelisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer. Gespräch mit dem Vorsitzenden der IDG und Direktor der IDIHK Grisha Alroi Arloser (Themen: Wirtschaftsentwicklung in Israel, Beziehung zu Außenhandelspartnern, Kennzeichnungspflicht, Rolle und Einflussmacht von BDS)
Alarmsignale seien, wie die Gastgeber betonen, BDS – Demonstrationen u.a. in Hamburg und Bonn.
In Israel sowie dem Westjordanland werde von offizieller Seite (Regierungen, Behörden) sehr wenig unternommen, um die Zusammenarbeit von Israelis und Palästinensern zu fördern. Initiativen gebe es nur von Privatleuten und NGOs. Allerdings gebe es ein Zentrum der Begegnung zwischen Israelis und Palästinensern, für das auch die Personalkontrollen vereinfacht seien. Deshalb hat die Kammer Beziehungen angeknüpft zu allen palästinensischen Bürgermeistern. Sobald allerdings eine dritte Person zu den Partnern stößt, werden die Gespräch schwierig. Dennoch bleibt, dass für Palästina Israel mit 5 Mrd US-Dollar der größte Handelspartner ist. Palästina wäre ohne Israel nicht lebensfähig.
Israel hat mit der EU ein Assoziierungsabkommen, d. h. es besteht Zollfreiheit. Dieses gilt nicht für das Westjordanland, was durch die Rechtsprechung seit Jahren geklärt ist. Insofern müssen Produkte aus dem Westjordanland schon lange gesondert gekennzeichnet werden. Der ausdrückliche Beschluss der EU bringt insofern keine Neuerung. Seine Bedeutung liegt vielmehr in der Signalwirkung gegenüber Organisationen wie BDS und anderen. BDS wird in Israel weniger als wirtschaftlich gefährlich, sondern als gesellschaftlich-politisch problematisch erfahren, zumal inzwischen Wissenschaftler, Künstler u. a. des Öfteren in verschiedenen Ländern von Konferenzen, Universitätsveranstaltungen, Konzerten usw. wie Parias ausgeschlossen worden sind und offenbar eine breite Diskriminierung angestrebt wird.
24.05.2016
Rückflug